Strom – Preisvergleich: (doc) Der Vergleich der Strompreise vergangene Woche in der ff (11/2020: Grün, günstig, gut?) hat der ...
Gesellschaft & Wissen
Die letzten Zeugen
Aus ff 12 vom Donnerstag, den 19. März 2020
Robert Holton ist einer der Letzten, die von der Vertreibung der Juden aus Meran im Jahr 1939 erzählen können. Unsere Autorin Sabine Mayr hat ihn in London getroffen.
Die Villa außerhalb von London, in der wir Robert und Shirley Holton treffen, hat Robert Holton in den Sechzigerjahren selbst entworfen. Holton, Zahnarzt in Pension, ist 1935 in Meran geboren – als Sohn von Nourie Gabay und Moritz Honig. 1939 musste die jüdische Familie Südtirol verlassen, die faschistischen „Rassengesetze“ hatten den Juden in Italien alle Rechte genommen. Shirley ist in Yorkshire geboren und hat 48 Jahre lang für das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland gearbeitet. 1988 setzte sie gegen den Widerstand ihrer männlichen Kollegen ein regelmäßiges Brustkrebs-Screening durch. Shirley und Robert sind seit 1984 verheiratet.
Es gibt nur mehr wenige Juden aus Südtirol, die aus eigener Anschauung von Verfolgung und Vertreibung erzählen können. Robert Holton ist einer von ihnen. Es gilt, die Erinnerung zu bewahren, bevor die letzten Zeitzeugen sterben.
ff: Herr Holton, wann musste Ihre Familie aus Meran flüchten?
Robert Holton: Mein Vater und meine Mutter sind mit mir 1939 wenige Wochen vor Kriegsausbruch nach England geflüchtet.
Mein Vater war sich sicher, dass es zum Krieg kommen würde.
Was war Ihr Vater von Beruf?
Robert Holton: Kohlehändler. Er hatte einen ansehnlichen Handel aufgebaut. Ich erinnere mich, dass ich mit ungefähr dreieinhalb Jahren in der Kabine seines altmodischen Kohlenwagens saß. Ich weiß noch, dass wir zu einem der Hotels gefahren sind, die er beliefert hat. Es war kein einfaches Geschäft. Mein Vater hat immer den schwierigeren Weg gewählt, wenn es um die Geschäfte ging, Gewinn hat er mit dem Kohlehandel nie viel gemacht.
Woran können Sie sich noch erinnern?
Robert Holton: Ich habe nur wenige Erinnerungen an Meran. Ich kann mich an den Tappeinerweg erinnern, der auf einem Foto mit meinem Großvater Josef Honig zu sehen ist. Ich erinnere mich an das Haus von Sabetay Gabay, meinem Großvaters mütterlicherseits, und an die wunderbaren Vögel in Käfigen in seinem Garten.
Josef Honig, der Großvater, stellte Joghurt her.
Robert Holton: Er war ein sehr feiner Mann. Die Geschichte mit dem Joghurt kenne ich aus Erzählungen meiner Eltern. Ich habe meinen Vater öfter gefragt, warum er von den vielen schönen Sachen, die sie besaßen, ausgerechnet eine Joghurtmaschine nach England gerettet hat. Meine Eltern mussten in großer Eile flüchten und nahmen ausgerechnet eine Joghurtbox mit. Die „Joghurtkiste“, wie sie mein Vater nannte, war eine hölzerne Box mit einer Glühbirne. Mein Vater war immer sehr emotional, wenn es um Meran ging. Er hatte jeden Gedanken an die Zeit und die Umstände damals verdrängt.
Dieses Interview müsste eigentlich mit dem Mädchen auf dem Cover des Buches „Mörderische Heimat. Verdrängte Lebensgeschichten jüdischer Familien in Bozen und Meran“ (Joachim Innerhofer und Sabine Mayr, Edition Raetia, 2015. Anm. der Red.) beginnen. Mit Aziadé Gabay, 1924 als Tochter des Antiquitäten- und Teppichhändlers Suleiman Gabay in Meran geboren. Sie hat den lange vergeblich gesuchten Kontakt zu ihrem Cousin Robert Holton ermöglicht.
Robert Holtons Großeltern Josef Honig und Helene Pflugeisen waren an der Wende zum 20. Jahrhundert mit ihren Söhnen Hermann und Moritz aus Lemberg in Galizien nach Meran gekommen. Josef Honig arbeitete im Kurort als Masseur und betrieb eine „Joghurt- und Kefir-Anstalt“. 1923 erlag Helene einem längeren Leiden, vermutlich der Grund für die Übersiedlung nach Meran. Moritz Honig handelte mit Holz und Kohlen und lernte in Meran Aziadés Tante, Suleiman Gabays Schwester Nourie, kennen. 1930 heirateten sie in der Synagoge. Am 25. Juli 1935 kam ihr Sohn Robert zur Welt. Die Familien Honig und Gabay förderten die jüdische Gemeinde.
Können Sie sich an die Flucht aus Meran erinnern?
Robert Holton: Ich war damals erst vier Jahre alt. An den Flug von der Schweiz nach England kann ich mich nicht erinnern, aber an Croydon Airport, wo wir ausstiegen. Mein Vater hatte zwei englische Damen namens Southwood kennen gelernt, die entweder als Touristinnen in Meran gewesen oder mit einer Person bekannt waren, die in Meran Urlaub gemacht hatte. Sie lebten in Ilford, einer kleinen Stadt östlich von London. Bei den zwei nicht jüdischen Damen lebten wir ein paar Monate lang.
Ihr Onkel Hermann Honig war in Meran Rechtsanwalt.
Robert Holton: Mein Onkel war mit Ludmilla Reinstadler aus St. Marein in der Steiermark verheiratet. Luzie war nicht jüdisch. Mein Onkel sagte: Es wird keine Probleme geben, wir gehen nirgendwo hin. Mein Vater hatte hingegen bereits etwas gespürt. „He took vibes“ oder „vibrations“, würde man auf Englisch sagen. Eine Woche später trafen sich die Brüder zufällig vor dem Londoner Bahnhof Victoria Station. Sie landeten schließlich beide in Kensington. Mein Vater meldete sich zum Dienst in der Armee. Als Einwanderer brachte er es nur zu den „Pionieren“, die anderen Waffengattungen waren Flüchtlingen verschlossen. Wegen einer Verletzung am Knie wurde er ein paar Monate später entlassen.
Diente auch Ihr Onkel im britischen Heer?
Robert Holton: Mein Onkel war ein ziemlich smarter Bursche. Als Rechtsanwalt konnte er in England nicht arbeiten. Er hätte wieder ganz von vorne anfangen müssen. Er wurde als feindlicher Ausländer auf der Isle of Man interniert, bis man in Großbritannien erkannte, dass all diese Flüchtlinge aus den von den Nazis besetzten Gebieten harmlos waren und sie freiließ. Für meinen Onkel war diese Zeit auf der Isle of Man aber eine gute Erfahrung, weil er dort zwei oder drei andere Personen in ähnlicher Situation kennenlernte, mit denen er nach dem Krieg eine Firma für Damenmode gründete. Die Firma hieß „Anglo-French Designs“. Sie betrieben eine kleine Fabrik im Londoner Stadtteil Soho. Meine Tante entwarf zwar etwas altmodische Kleider, aber sie kamen damit während des Krieges über die Runden. Weil man in England auf einen deutschen Namen nicht besonders gut reagierte, änderte er den Namen nach dem Krieg zu „Hemming“. Darauf änderte auch mein Vater seinen Namen zu „Holton“. 1951 wanderten Luzie und Hermann nach Sydney aus.
Was hat Ihr Vater in London beruflich gemacht?
Robert Holton: Er arbeitete als Juniorkellner im St. Ermin’s Hotel. Er kam immer erschöpft nach Hause, denn es gab einen Wettkampf zwischen den Kellnern, wer die Gäste schneller bediente. Dann eröffnete er ein kleines Unternehmen für Galvanotechnik in einem ehemaligen Stall, in dem er Gegenstände wie Zigarettenetuis oder Geschirr mit Silber oder Chrom beschichtete. Es war erschütternd zu sehen, unter welchen Umständen er arbeitete, doch damals versuchte man irgendwie durchzukommen, und wenn es nicht gelang, gab man sich selbst die Schuld. Mein Vater ging mit diesem Vorhaben bankrott.
Hat Ihr Vater von Nazis in Meran erzählt?
Robert Holton: Er wollte nie darüber reden. Es war schwierig genug, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Dazu kamen der Krieg, die Bombardierungen. Viele unserer Nachbarn suchten bei Bombenalarm U-Bahn-Stationen auf. Eines Nachts schliefen auch wir in einer U-Bahn-Station auf dem Bahnsteig, an dem die Züge vorbeifuhren. Es war schrecklich, und mein Vater entschied, künftig in seinem Bett zu schlafen. Wir hatten einmal großes Glück, denn knapp 100 Meter entfernt gab es einen V1-Bombentreffer, der mehrere Häuser zerstörte.
Moritz Honig war aschkenasischer Herkunft. Nourie kam aus einer sephardisch-jüdischen Familie. Franz Kafka erwähnt ihren Vater, Sabetay Gabay, im Brief an Max Brod und Felix Weltsch vom 10. April 1920. „Dort war zum Beispiel ein türkisch-jüdischer Teppichhändler, mit dem ich meine paar hebräischen Worte gewechselt habe, ein Türke an Gestalt, Unbeweglichkeit und Frieden, ein Duzfreund des Konstantinopler Großrabbiners, den er merkwürdiger Weise für einen Zionisten hält.“
Als „Prager Zionisten“ bezeichnete Franz Kafka den Arzt Josef Kohn, den damaligen Leiter des jüdischen Sanatoriums in Meran, der Kafka im April und Mai 1920 während seines Aufenthalts behandelte. Kohn wurde 1882 in der ostböhmischen Stadt Leitomischl (Litomyšl) geboren und war 1908 nach Meran gekommen. Kohn war nur ein Jahr älter als Kafka, damals noch ledig, engagierte sich im Vorstand der Königswarter-Stiftung und später in den verschiedenen Gremien der jüdischen Gemeinde.
Sabetay Gabay, 1860 in Istanbul geboren, zog um die Jahrhundertwende nach München und eröffnete dort als erster jüdischer Teppichhändler der Stadt ein Handelshaus für Teppiche und Antiquitäten. Die Schönheit seiner Tochter Dilber erregte die Aufmerksamkeit des Prinzen Heinrich von Bayern. Aus der langjährigen Beziehung ging ein Sohn hervor, der seinen Vater allerdings nie kennenlernte, da dieser im Ersten Weltkrieg am 7. November 1916 am Monte Sate einer Schussverletzung erlag.
Hat Ihr Vater etwas über die jüdische Gemeinde erzählt?
Robert Holton: Ich kann nichts über die Synagoge in Meran sagen, weil meine Eltern sich nicht allzu sehr um Religion gekümmert haben. Ich selber bin, ehrlich gesagt, kein bisschen religiös. Für mich spielt es keine Rolle, ob jemand jüdisch oder nicht jüdisch ist. Ich ging in christliche Schulen und in eine jüdische Schule. Meine Eltern hießen jeden willkommen, der mir etwas beibringen konnte. 1948 wurde ich schließlich in einer orthodoxen jüdischen Schule unterrichtet. Es war die vom Rabbiner Solomon Schonfeld mitbegründete „Hasmonean Grammar School“ in Golders Green. Sie war eben erst eröffnet worden und hatte gerade einmal sechs Schüler. Doch selbst diese Schule, die damals dringend Schüler suchte, wollte mich zuerst nicht aufnehmen.
Solomon Schonfeld hatte an der Jeschiwa, der jüdischen Hochschule, in Nitra bei Rabbiner Michael Weissmandl studiert, der später im slowakischen Widerstand aktiv war. Ab 1938 hat Rabbiner Schonfeld orthodoxe Kinder aus den besetzten Gebieten nach England gerettet.
Robert Holton: Er hatte wegen der Kindertransporte einen ausgezeichneten Ruf. Er war ein hochgewachsener, Achtung gebietender Mann. Ich habe ihn in der Schule gelegentlich gesehen. Am Morgen wurde meist ein Lied gesungen, und Solomon Schonfeld stand manchmal neben dem Schuldirektor Herrn Stanton und hörte sich das Lied an. Bei mir ging es in der Hasmonean Grammar School endlich aufwärts. Ich habe erkannt, dass ich in der Gosse landen würde, wenn ich mich nicht wirklich bemühte „to get it going“, in die Gänge zu kommen, wie die Engländer sagen. Also stand ich um drei oder vier Uhr in der Früh auf, um zu lernen. Wir mussten mehrmals am Tag beten und uns bis zu drei Stunden lang mit religiösen Fragen auseinandersetzen. Ich brauchte allein fürs Hin- und Zurückfahren jeweils eineinhalb Stunden und musste dann zu Hause noch Hausaufgaben machen.
Shirley Holton: Seine Eltern führten ja einen deutschsprachigen Haushalt. Robert kam mit vier Jahren nach England. Er konnte noch nicht auf Deutsch schreiben und sollte nun in ein englisches Schulsystem eingeschult werden, wo er noch gar nicht einmal Englisch sprechen konnte. Und trotzdem hat er es geschafft, bis hin zum Studium an der Universität, und wurde Zahnarzt, und ein sehr guter obendrein.
Die Schwierigkeiten, mit denen Kinder nach der Flucht fertig werden mussten, wurden lange übersehen.
Shirley Holton: Ich habe zwei Freunde, die mit einem Kindertransport nach England gekommen sind. Dorothy Fleming Fleischer, die mit ihrer Schwester nach England kam. Sie wurde eine ausgezeichnete Psychologin und hielt zahlreiche Vorträge über die Kindertransporte. Mit einem Kindertransport aus Wien kam auch mein Freund Emanuel Bergmann nach London. Auch er war eine sehr gelehrte Person. Das waren alles kluge Leute, die dankbar waren und etwas aus ihrem Leben gemacht haben, wie auch Stephanie Shirley, die Anfang der Sechzigerjahre eine Softwarefirma gründete. Beim Bahnhof Liverpool Street Station gibt es ein Denkmal für die Tausenden Kinder, die mit den Kindertransporten nach England kamen.
Was konnten Ihre Eltern noch aus Meran mitnehmen?
Shirley Holton: Robert hat noch den jüdischen Ehevertrag, die Ketubba, seiner Eltern, die uns später in England geholfen hat, als wir zwei geheiratet haben. Mit der Ketubba konnte Robert mühelos nachweisen, dass er jüdisch war.
Robert Holton: Meine Frau ist wirklich fantastisch. Ohne ihre Erinnerung wäre das Interview nur kurz ausgefallen, da ich nach achtzig Jahren von Meran leider nur mehr wenig berichten kann.
Im Februar 2015 wohnten Aziadé Gabay und Roberto Furcht der Vorstellung des Buches „Mörderische Heimat“ in der Meraner Synagoge bei. Elf weitere Zeitzeugen und zahlreiche Nachkommen einstiger Südtiroler Jüdinnen und Juden waren für den Buch-Gedenkband befragt worden. Aziadé starb am 16. September 2019.
Moritz Honig starb 1978 in London, Nourie im Jahr 1981. Hermann Hemming 1990, im Alter von 97 Jahren, in Sydney. In Meran hatte er in seiner Anwaltskanzlei, die er mit Max Markart und Benedikt Galler führte, unter anderem die jüdische Gemeinde vertreten, für die er auch Ehrenämter bekleidet hatte. Hermann Honig hat sich in Meran ehrenamtlich auch für das Rote Kreuz engagiert.
Im August 1938 wurde die Familie Honig in der diskriminierenden Zählung der in Italien lebenden „Juden“ erfasst. Im Oktober 1939 wurde Josef Honig, der in Meran blieb, nachdem seine Söhne nach England geflüchtet waren, die italienische Staatsbürgerschaft aberkannt, die er 1923 erhalten hatte. Am 16. September 1943 wurde er ins GIL-Gebäude Casa del Balilla in der Otto-Huber-Straße 36 gebracht und mit 25 weiteren Mitgliedern der jüdischen Gemeinde ins KZ Reichenau bei Innsbruck deportiert. Der Tortur im KZ erlag Josef Honig am 22. Januar 1944. Die Stadt Meran hat einen Stolperstein zu seinem Andenken verlegt.
Interview: Sabine Mayr
Sabine Mayr, 51, ist zusammen mit Joachim Innerhofer die Autorin von „Mörderische Heimat. Verdrängte Lebensgeschichten jüdischer Familien in Bozen und Meran“ (Edition Raetia 2015). Zuletzt erschien von ihr im StudienVerlag: „Von Heinrich Heine bis David Vogel. Das andere Meran aus jüdischer Perspektive“.
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

Ein Topf für alle
Die italienische Regierung schnürt ein Krisenpaket von 25 Milliarden Euro. „Sehr positiv“, sagt Gewerkschafter Tony Tschenett. Aber es werde zusätzliche Mittel brauchen.
-

Bis auf Weiteres geschlossen
Der Landtag tagt nicht, das Team K befindet sich in Quarantäne, Regierung und Opposition rufen zum Zusammenhalt auf. Corona hat die demokratischen Spielregeln verändert.





















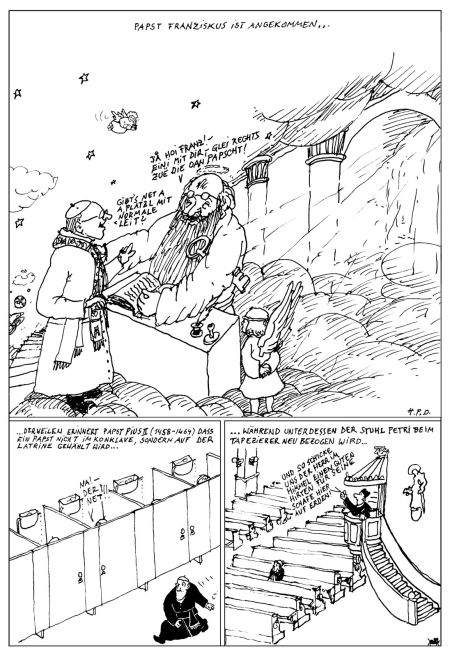





Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.