Der Wintersportort Gröden war einer der Brennpunkte des Coronavirus. Wie in Ischgl hat man auch hier gezögert, den Laden dichtzumachen. Warum das Krisenmanagement trotzdem besser lief.
Gesellschaft & Wissen
Ausgegrenzt und angezählt
Aus ff 15 vom Donnerstag, den 09. April 2020

Abgeschottete Seniorenheime, isolierte Bewohner, steigende Infektionszahlen, Tote: Das Coronavirus trifft unsere Ältesten am härtesten.
„Die Situation ist sehr schwierig. Mehr kann ich nicht sagen. Wenden Sie sich bitte an die Heimdirektion.“
Wer sich dieser Tage über die Situation im Seniorenheim St. Durich in St. Ulrich erkundigen will, tut sich schwer. Das liegt weniger an der spärlichen Auskunft im Sekretariat des Heimes. Es hat vielmehr damit zu tun, dass die Verantwortliche des Heimes, die Direktorin, nicht zur Verfügung steht: Sie befindet sich – wie andere Mitarbeiter ihrer Einrichtung auch – in Quarantäne.
Im März starben fünf Heimbewohner am Coronavirus. Etliche der Senioren sind infiziert und befinden sich in eigens abgeschirmten Räumen im Haus. Weil auch einige Heimmitarbeiter das Virus in sich tragen und in Quarantäne sind, herrscht akuter Personalmangel. Die verbliebenen Mitarbeiter stehen im Dauereinsatz.
Das Grödner Seniorenheim mag nicht unbedingt stellvertretend für die anderen 76 Seniorenheime im Land sein. Doch an seinem Beispiel lässt sich ermessen, was anderen, bislang verschonten Häusern noch blühen kann – dabei gilt seit dem 6. März ein Besuchsverbot. Dass St. Durich aber auch keine Ausnahme ist, zeigt sich etwa an den Seniorenwohnheimen in Kastelruth, Niederdorf, Eppan, Meran/Untermais oder St. Leonhard. In Passeier beklagt man sieben Todesfälle in drei Wochen.
Die Lage ist angespannt. Landesweit. In Heimen mit höheren Infektionszahlen behilft man sich mittlerweile mit Krankenpflegepersonal der örtlichen Gesundheitssprengel. Mitunter kommen auch Sozialbetreuer zum Einsatz und immer öfter springen auch freiwillige Helferinnen des Weißen Kreuzes in die Bresche.
Die Coronakrise stellt die Seniorenwohnheime vor ihre bislang wohl größte Herausforderung. Nach den Intensivstationen in den Krankenhäusern haben immer mehr Alteneinrichtungen mit dem aggressiven Virus zu kämpfen – trotz aller Schutzvorkehrungen, trotz des beispielhaften und unermüdlichen Einsatzes nahezu aller Pflegekräfte in den Heimen.
Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Warum werden auch noch rund einen Monat nach dem landesweiten Heimbesuchsverbot Neuinfektionen am laufenden Band gemeldet? Und was bedeutet die soziale Isolierung für die rund 4.400 alten Menschen in Südtirols Heimen?
Gröden war Anfang März die erste Kleinregion des Landes, die von der Covid-19-Welle erfasst wurde. Viele Skitouristen aus der Lombardei und Venetien haben dafür gesorgt, dass sich die Pandemie vor Ort besonders schnell ausbreiten konnte und alsbald auch jene Bevölkerungsgruppe erreichte, die dem Virus am schutzlosesten ausgeliefert ist: die alten Menschen.
„Die Situation im St. Ulricher Seniorenheim hat sich mittlerweile etwas stabilisiert“, sagt Evi Näckler, stellvertretende Direktorin der Sozialdienste und Seniorenwohnheime der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern. Bis die Heimleiterin zurückkommt – das soll diese Woche der Fall sein – ist Näckler mit der Führung des Hauses betraut.
Dass es im März zu einer regelrechten Sterbewelle in der Einrichtung gekommen ist, ist nicht allein dem Virus geschuldet. Genaue Zahlen hat Näckler in der Zentrale der Bezirksgemeinschaft im Bozner Kampill-Center zwar noch nicht zur Hand, sie meint aber: „Ich kann versichern, dass weniger als die Hälfte der Verstorbenen Covid-19-Patienten waren.“
Die bislang sehr schwierige Personalsituation aufgrund der Krankschreibungen und Quarantäne-Fälle scheint sich zu entspannen, die ersten Mitarbeiter melden sich zurück. „Es gibt auch Heimbewohner, die von der Viruserkrankung genesen sind“, sagt Näckler und versucht, auch etwas Positives zu vermelden.
Landesweit wurden seit Beginn der ersten Covid-19-Erkrankungen bis Redaktionsschluss am Dienstag 62 Todesfälle von den Südtiroler Seniorenwohnheimen gemeldet.
Bereits seit 9. März versucht ein Krisenstab, der vom Verband der Seniorenwohnheime und vom Amt für Senioren eingerichtet wurde, den Heimen rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In enger Zusammenarbeit mit der Task Force des Sanitätsbetriebes koordiniert er die Lage, gibt Situationsberichte weiter, spricht sich laufend mit den Behörden ab, hilft bei der Beschaffung von Schutzausrüstung und versucht, Lösungen bei Problemen wie dem Personalmangel zu finden.
Dieser hat sich zuletzt in Heimen wie beispielsweise jenem in Kastelruth zugespitzt; dort haben sich etliche Mitarbeiter infiziert und mussten in zwei Wochen in Quarantäne. Doch Ersatz zu finden, ist alles andere als leicht und führt zu großen Mehrkosten. Soziallandesrätin Waltraud Deeg und die Stiftung Südtiroler Sparkasse haben finanzielle Unterstützung zur Deckung der Mehrkosten zugesagt.
„Die Situation in unseren Heimen ist wahrlich nicht einfach, weder für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch für die Bewohner und die Angehörigen“, heißt es im Verband der Seniorenwohnheime. Vor allem der Umstand, dass die alten Menschen weder Besuche empfangen noch das Heim verlassen können, sei für alle schmerzlich.
Tatsächlich ist die strikte Isolation, je länger sie andauert, gerade für alte Menschen Gift: Die psychosoziale Befindlichkeit verschlechtert sich, depressive Verläufe nehmen zu. Dabei wird die Zahl der Depressiven in mitteleuropäischen Seniorenheimen schon in normalen Zeiten auf ein Viertel geschätzt. Auch für Angehörige ist die Situation belastend, besonders dann, wenn es nicht möglich ist, von schwer erkrankten Eltern, Großeltern oder engen Verwandten persönlich Abschied zu nehmen.
Grundsätzlich versuchen die Heimleitungen in allen erdenklichen Formen den Kontakt ihrer Bewohner mit der Außenwelt nicht gänzlich abbrechen zu lassen: Die Mittel hierfür reichen von WhatsApp-Videoanrufen bis zum Aufruf, Kinderzeichnungen einzuschicken.
Die Corona-Krise – sie hat auch zu einer Krise unserer Altenbetreuung geführt; und das, obwohl Pflegekräfte und medizinisches Personal in den Krankenhäusern ihr Äußerstes geben. Das manche Schlagzeile dabei über das Ziel hinausgeschossen ist, zeigt die Reaktion von Helene Trippacher, Pflegedienstleiterin des Öffentlichen Betriebs für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB) „Zum Heiligen Geist“ in Brixen. „Die Negativschlagzeilen, die man jetzt über die Seniorenheime liest, schädigen nicht nur den Ruf der Einrichtungen, sondern auch den Ruf von uns Pflegekräften“, sagt sie. Wortkarg gibt sich auch ihre Direktorin, Michaela Summerer. Sie verweist auf die Pressemitteilungen des Hauses: In den vier Strukturen des Brixner ÖBPB sind sowohl mehrere Bewohner als auch Mitarbeiterinnen positiv auf Covid-19 getestet worden.
Anders Rita Obkircher. Die Vorsitzende des Verbandes der Pflegedienstleiter der Seniorenwohnheime verweist auf die Bemühungen des Krisenstabes des Verbandes der Seniorenwohnheime, den Vormarsch des Virus zu stoppen. So habe man bereits am
9. März sehr klare und einheitliche Richtlinien zu den Schutzmaßnahmen für Südtirols Seniorenheime erarbeitet.
„Wir haben versucht zu vermeiden, dass das Virus sich in den Heimen ausbreiten kann. Aber da hätten wir mit diesen schon auf den Mond fliegen müssen“, sagt Obkircher. Denn: „Wenn die Infektionen schon vor der Besuchersperre in den Heimen stattgefunden haben, helfen auch die besten Vorsorgemaßnahmen nicht.“ Für sie verhält es sich ähnlich wie bei Grippeviren: Auch die ist man kaum imstande, vollständig abzuwehren. Immerhin: Gegen Influenza kann man sich impfen lassen.
Doch wie lässt es sich erklären, dass es rund einen Monat nach dem Besucherstopp in den Wohnheimen zu Neuinfektionen kommen kann – zumal der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen in der Regel fünf bis sechs Tage beträgt (und Verdachtsfälle deshalb zwei Wochen isoliert werden)? „Wie in den Krankenhäusern auch hat es anfängliche -Lieferschwierigkeiten bei Masken und Schutzkleidung gegeben“, sagt Obkircher. Vor allem Masken der Kategorie FFP2, die es zum Schutz bei der Betreuung von Covid-19-Patienten braucht, seien zu Beginn kaum verfügbar gewesen.
Klarer formuliert wird die Kritik dieser Tage indessen im Altersheim von St. Leonhard. Dort spricht man von einer „stiefmütterlichen Behandlung“ von Alters- und Pflegeheimen. „Erst nachdem der erste Heimgast positiv auf Covid-19 getestet worden war, haben wir Tage später Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter bekommen“, lässt sich Silvia Lanthaler in der Tageszeitung Dolomiten zitieren. In der Zwischenzeit, so die unausgesprochene Folgerung, hatte wohl auch das Virus größere Möglichkeit, sich auszubreiten.
Sämtliche Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Infektion einzuhalten, ist in Seniorenheimen ohnehin schwierig. „Das sind große Wohngemeinschaften, die gerade auch auf soziale Nähe setzen“, sagt Christian Wenter. Der Primar der geriatrischen Abteilung im Krankenhaus Meran, die derzeit aus zwei Sektionen für Covid-19-Patienten besteht, sieht Handlungsbedarf: „Die Heimleitungen und Pflegekräfte tun sich schwer, das, was eine gute Fürsorge in Seniorenheimen ist, nun auf den Kopf zu stellen. Die Kontakte zu den Bewohnern gehören auf das Notwendigste beschränkt.“ Pfleger und Pflegerinnen seien nicht darauf vorbereitet, physische und soziale Distanz zu üben. „Hierzu braucht es die Grundsatzüberzeugung, dass dies in dieser Ausnahmesituation dringend notwendig ist“, sagt Wenter.
Weil in der derzeitigen Entwicklungsphase in Wohneinrichtungen die Infektion wohl nur mehr über das Personal eingeschleust werden kann, gelte es, die Zugänge zu den Strukturen und zu den Zimmern der Bewohner radikal auf möglichst wenige Mitarbeiter und möglichst seltene Kontakte zu reduzieren. Ebenso sei es angebracht, dass die Pflegekräfte laufend ihren eigenen Gesundheitszustand genau beobachten.
Eine leichte Vorahnung, was mit der Coronakrise auf die Altenbetreuung zukommt, muss man wohl im Seniorenheim von Dorf Tirol gehabt haben. Dort hat Heimarzt Eugen Sleiter dafür gesorgt, dass bereits Mitte Dezember präventiv Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel eingekauft wurden. Auch die Türen schloss man rund zwei Wochen früher als im Rest des Landes – was bei vielen Angehörigen auf Unverständnis stieß. Ebenso hat man im Heim dafür gesorgt, dass gemeinschaftlich genutzte Räume geschlossen wurden und die Senioren auf ihren Zimmern essen.
Jedem Stockwerk wurde fixes Personal zugeteilt, um Kreuzungswege zu verhindern und im Notfall die Ausbreitung des Virus auf nur einen Stock zu begrenzen. „Bis jetzt“, sagt Sleiter, „hat es geklappt, hoffen wir, dass es so bleibt.“
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

Die kreativsten Köpfe
Ob in der Mode, im Produkt- oder Objektdesign – Südtirols Designer feiern weltweit Erfolge. Wer sie sind. Wie sie den Corona-Alltag erleben. Und welche Mundschutzmasken sie für ff spontan entworfen haben.
-

Die Herkulesaufgabe
Was Seuchen mit einer Gesellschaft machen, hat die Historikerin Elisabeth Dietrich-Daum erforscht. Corona, sagt sie, ist ein „Stresstest für die Gesellschaft und jeden Einzelnen“.




















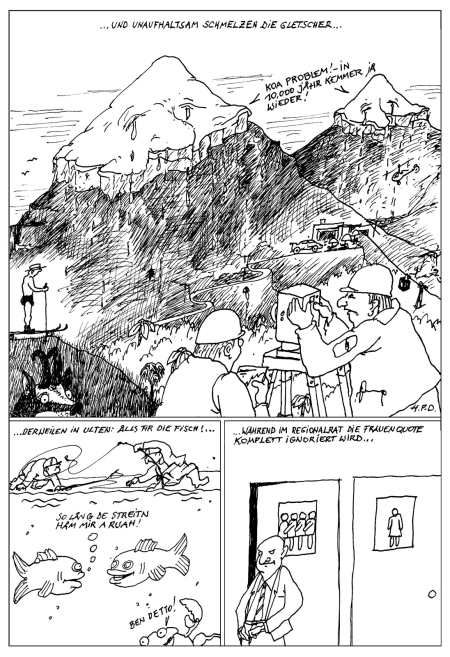






Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.