Maria und Josef sind Südtiroler wie die meisten von uns: gesund, zufrieden, der Tradition verhaftet. Manch einer würde das für langweilig halten, Maria und Josef sind trotzdem glücklich.
Gesellschaft & Wissen
Ein Ort für Bedürftige
Aus ff 40 vom Donnerstag, den 01. Oktober 2020

Bibliotheken sind Orte der Begegnung, für Menschen, die suchen, was ihnen fehlt. Doch wie stehen wir zu diesen Orten? (Beitrag von Hans Drumbl)
Mein Idealbild einer Bibliothek ist aus verschiedenen Schichten zusammengesetzt. Da war sehr früh das Lesen alter Erstdrucke im Augustiner-Lesesaal der Nationalbibliothek in Wien und der Gedanke daran, dass an einem dieser Tische wenige Jahre zuvor Ingeborg Bachmann ihre Dissertation geschrieben hat. Später, in den Sechzigerjahren, die Biblioteca Civica von Bergamo, in der ich zwei Handschriften für meine Dissertation einsehen wollte und wo alle Sitzplätze von Schülerinnen und Schülern besetzt waren, die dort ihre Hausaufgaben machten. Es war meine erste Begegnung mit dem mir unbekannten Italien des sozialen Aufbruchs, der Schule für alle, einer Gesellschaft, die ihre Aufgabe ernst nahm, allen Kindern den Zugang zu Kultur und Bildung zu ermöglichen.
Ein Jahrzehnt später, im Frühjahr 1978 fand ich eine überraschende Bestätigung des Konzepts der „Bibliothek für alle“ in Paris, in der ultrainnovativen, weltweit einmaligen „Bibliothèque Publique d’Information“ im Centre Pompidou. Das Centre Pompidou war vom ersten Tag an überlaufen von Schülern der Pariser Schulen, die in der großzügig geplanten Bibliothek studierten. Aber wie! Da saßen Jugendliche auf dem Fußboden und hatten Stapel von Büchern vor sich aufgetürmt, sie diskutierten, suchten nach Belegstellen, die sie sich vorlasen und in ihre Notizbücher eintrugen. Allein die Kultur des leisen Sprechens zu erleben, war eine Reise wert.
Schon Jahre zuvor hatte ich eine junge Frau auf dem Fußboden einer Bibliothek sitzen sehen. Sie las in einem dicken Folianten, dem sie nicht anders beikam als im Sitzen auf dem Fußboden. Und die anderen Besucher, Priester und Professoren, machten einen respektvollen Bogen um sie. Das war 1966 im Lesesaal der Vatikanischen Bibliothek, der Biblioteca Apostolica Vaticana.
Menschen gehen bewusst in eine Bibliothek, und das verbindet sie mit den Menschen, die sich ebenfalls bewusst an diesen Ort begeben, einen Begegnungsort. Sie gehen in die Bibliothek, ohne dass sie sonst etwas gemeinsam hätten.
In der Bibliothek treffen Gleichberechtigte aufeinander, eigentlich Gleichbedürftige. Bibliotheken sind Orte für Bedürftige. Die Besucher suchen, was ihnen fehlt – sie hoffen, es in der Bibliothek zu finden. Die Besucher, die in die Bibliothek kommen, haben gemeinsam, dass sie Bedürftige sind.
Diese Erkenntnis wirkt unerhört vor dem Hintergrund der riesigen Zahl von virtuellen Begegnungen, die wir in den geschlossenen Räumen der Medien machen, in den von Likes und Freundschaftsbekundungen abgegrenzten Räumen, in denen Motive wie Ausgrenzung, Lüge und Hass immer stärker werden. In den Räumen der Bibliothek sind die Medien nur als Hilfsmittel präsent. Es ist beinahe wie eine Rückkehr in die Pionierzeit des Internet, als das Wort „vernetzt“ noch mit Ehrfurcht ausgesprochen wurde.
In der Teßmann-Bibliothek, der Landesbibliothek der Provinz Bozen, bin ich immer wieder überrascht, wie viele der Neuerscheinungen, die einladend im Eingangsraum ausgestellt sind, meine ganz persönlichen kulturellen Interessen berühren. Man kann sie direkt von der Ablage nach Hause mitnehmen.
In die „Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann“ geht allerdings nur ein Teil der Leser aus meiner Stadt. Andere gehen in die „italienische Landesbibliothek“, die „Biblioteca Provinciale Italiana“ mit dem schönen und sinnträchtigen lateinischen Namen, „Claudia Augusta“, der römischen Straße, die Ober-italien mit Bayern verband. Es wurde also eine „italienische Landesbibliothek“ zur bestehenden „Landesbibliothek“ hinzugefügt, was allerdings keineswegs zur Folge hat, dass dadurch aus der „Landesbibliothek Friedrich Teßmann“ eine „deutsche Landesbibliothek“ wird.
Bald werden die beiden Bibliotheken vereint sein, die alte „Landesbibliothek“ und die jüngere „italienische Landesbibliothek“, dazu kommt die „Biblioteca Civica“, die „Stadtbibliothek“ – ohne einschränkende sprachliche Kennzeichnung. Gehört sie vielleicht zu den „gemischtsprachigen Bibliotheken“, die auf der Homepage http://www.provinz.bz.it/kunst-kultur/bibliotheken-lesen/bibliotheken-in-suedtirol/oeffentliche-bibliotheken.asp erwähnt werden?
„Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung aller deutschen, ladinischen und gemischt-sprachigen öffentlichen Bibliotheken in Südtirol“, heißt es dort. Unbekümmert heißt es weiters: „Hier gelangen Sie zu ‚Öffentliche Bibliotheken in ausschließlich italienischer Sprache‘.“
Es gibt in unserem Land also gemischt-sprachige und ausschließlich italienische Bibliotheken. Wie sinnlos ist das? Was könnte denn an einer Bibliothek gemischtsprachig sein? Die Bücher? Die Leser? Was soll denn hier auf Teufel komm raus getrennt werden?
2006, als das Projekt für eine Vereinigung der Bibliothken in Bozen von einer politisch gesteuerten Bürgerversammlung abgelehnt wurde, waren es die zwei Direktorenposten für die italienischen Bibliotheken, die das Projekt zu Fall brachten. Bevor also noch der erste Gedanke der neuen Bibliothek gewidmet war, stand schon der Terminus „polo bibliotecario“ in den Zeitungen, um dann als „polo bibliotecario trilingue“ in den offiziellen Sprachgebrauch einzugehen. Den überrumpelten Übersetzern in den Ämtern der Provinz fiel nichts Besseres ein, als aus dem „polo“ ein „Bibliothekenzentrum“ zu machen.
Kenner von Karl Valentin und seiner Szene über die -
Semmelnknödel waren wohl nicht unter den Übersetzern.
Doch es sind bereits Spuren vorsichtigen Umdenkens zu finden: „Die ursprüngliche Vorstellung der Unterbringung von drei unabhängig voneinander funktionierenden Einheiten ist inzwischen der Vision von einem Bibliothekenzentrum als einem Betrieb gewichen.“ Immerhin ein „Betrieb“, aber könnte man diesen Betrieb nicht einfach als „Bibliothek“ bezeichnen, sodass aus dem „polo bibliotecario“ die „Biblioteca Civica e Provinciale Bolzano“ wird, also genau das, was sie tatsächlich ist, nämlich die „Stadt- und Landesbibliothek Bozen“?
Wie hölzern und lebensfremd klingen selbst die wohlmeinenden Worte auf der Internetseite der Provinz: Mit dem Bibliothekenzentrum entsteht für die deutsch-, italienisch- und ladinischsprachigen Südtiroler ein gemeinsamer Zugang zu Information und Wissen, ein Ort des Lernens und der Vertiefung und vor allem ein Ort des kulturellen Austauschs und der kulturellen Begegnung.
Und einfacher, aber erklärungsbedürftig: Die Bibliothek „versteht sich zudem als Treffpunkt in der Stadt Bozen für alle hier lebenden Sprachgruppen.“
Wie dieses „aller hier lebenden Sprachgruppen“ zu verstehen ist, lassen wir uns gerne von der Wiener Autorin Hanna Sukare sagen, die 2006 ihre Eindrücke von der 2003 eröffneten Wiener Hauptbücherei so zusammengefasst hat: Die Kinder der Immigranten scheinen in der Bibliothek ein zweites Zuhause gefunden zu haben. Die Bibliothek hat keine speziellen Programme angeboten, um die Jugendlichen ins Haus zu locken. Im Gegenteil, seit das neue Haus der Städtischen Bibliothek vor wenigen Jahren eröffnet wurde, sind die Jugendlichen da, als hätten sie auf dieses Haus gewartet. … Die Kinder und Jugendlichen vom Gürtel kommen nicht nur zum Surfen in die Bibliothek.
Die Bibliothek öffnet sich nach Osten hin in einer großen Glasfront. Vor der Glasfront stehen lange Tische, an denen Mädchen und Burschen neben Damen und Herren Bücher wälzen, schreiben, nachdenken, lesen. Einige Mädchen tragen Kopftücher, andere Piercings, neben dem Bärtigen mit Turban kratzt ein Kahlkopf sein Haupt.
Das Miteinanderleben der Kulturen wird hier nicht diskutiert. Es findet statt. Es findet statt in den Technikkojen, an den Tischen vor der Glasfront, auf der Freitreppe, die zur Eingangshalle führt. In der Eingangshalle stehen bequeme Sessel, die zum Zeitunglesen einladen, deutsch, türkisch, italienisch, arabisch, russisch, englisch, spanisch, polnisch, französisch – ganz nach Belieben.
Die Bibliothek zieht mich an. Ich komme gern hierher. Manchmal suche ich kein Buch. Ich komme nur, um ein paar Stunden in diesem Haus zu verbringen, das jeden willkommen heißt und die Leute in Ruhe miteinander sein lässt.
Hans Drumbl
Hans Drumbl, seit 1969 Professor für Deutsche Sprache und Literatur in Italien; seit 2014 emeritierter Professor der Freien Universität Bozen, von 2003 bis 2018 Editorialista des Corriere dell’Alto Adige. Seit 2002 sporadisch Kommentator in ff.
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

DER MEDIENSTAR
Dorothea Wierer (nd) Laut Marco Fontanesi von der Kommunikations- und Marketingagentur LifeCircus ist es „eine Sensation“: Im aktuellen ...
-

Marx und seine Tochter
FILM – MISS MARX: (gm) Eleonor Marx steht am Grab ihres Vaters Karl, gefasst und bereit, das Erbe des Revolutionärs (nun ja, Papier- und ...



















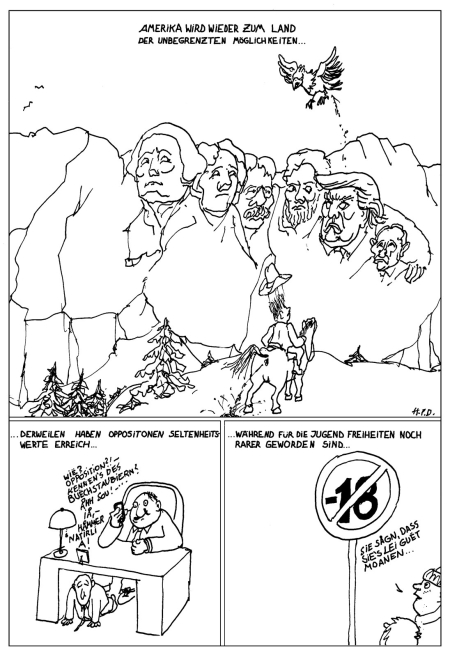






Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.