Wer übt jetzt Solidarität, und wer schaut nur auf seine eigenen Interessen? Leitartikel in ff 46/20
Gesellschaft & Wissen
Unter Druck
Aus ff 48 vom Donnerstag, den 26. November 2020

Wie bewältigen die Südtiroler Krankenhäuser die zweite Welle – ein Lagebericht.
Othmar Bernhart ist ein erfahrener, abgeklärter Arzt. Der 58-jährige Primar der Inneren Medizin am Krankenhaus Brixen hat im Laufe seiner Karriere viele schwierige Situationen erlebt und gemeistert. Am Wochenende Mitte November kam aber der Moment, an dem selbst er nicht mehr weiterwusste. Die Betten in seinem Krankenhaus wurden knapp, auch in den anderen Krankenhäusern gab es keine freien Betten. „Es hätte nicht viel gefehlt“, erzählt Bernhart, „und das Ganze wäre explodiert.“
Was er meint: Das Gesundheitssystem stand kurz vor dem Kollaps. Man überlegte bereits, Turnhallen einzurichten und Zelte aufzubauen, um die Patienten unterzubringen. Das konnte – gerade noch – vermieden werden. Die Lage aber ist immer noch angespannt. Ständig kommen neue Patienten. Die Dienstpläne erstellt man nicht mehr wöchentlich, sondern alle drei Tage „Es ist eine Extremsituation“, sagt der Primar.
Am 19. Oktober hat Bernhart umgestellt auf Corona. Die Abteilung für Innere Medizin des Krankenhauses Brixen, insgesamt 54 Betten, wurde zur Covid-Station. Von Woche zu Woche wurden weitere Abteilungen zu Covid-Stationen umfunktioniert, die HNO, die Chirurgie, die Urologie, die Plastische Chirurgie. Othmar Bernhart leitet jetzt de facto ein ganzes Corona-Krankenhaus.
„Irgendwie“, sagt er, „haben wir uns in einer trügerischen Sicherheit gewiegt. Es hat immer geheißen, wir seien gut vorbereitet, vor allem hinsichtlich der Intensivbetten. Man hat jedoch die große Anzahl an Normal-Covid-Patienten total unterschätzt.“ In den Krankenhäusern kann man seit einigen Wochen erleben, wie schnell selbst das an sich gute Südtiroler Gesundheitssystem unter massiven Druck geraten kann, wenn sich das Virus exponentiell verbreitet.
Am 5. November erklärt Landesgesundheitsrat Thomas Widmann im Landtag, dass man über den Sommer die Intensivbetten im Land auf 77 aufgestockt habe. „Und wir können schnell auf 100 gehen.“ Auch sei viel Personal eingestellt worden. Widmann verteidigt sich aber auch mit dem Hinweis darauf, dass die zweite Welle ganz Europa viel früher als erwartet erreicht habe. Und er teilt auch aus: „Wenn die Regeln eingehalten worden wären, hätte man heute nicht diese Zahlen.“
Der Arzt Klaus Hofer* kann da nur den Kopf schütteln. Woher man die genannten 77 oder gar 100 Betten, von denen Widmann spricht, hernehmen soll, ist dem Intensivmediziner ein Rätsel. Der Mittvierziger neigt nicht zu Alarmismus. Doch die Fallzahlen bereiten ihm Sorgen. „Wir sind heute schon fast am Limit. Und die Möglichkeiten, aufzustocken, sind gering, weil schlicht das Personal fehlt.“ Viele seiner Kollegen und er fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, er sagt: „Sie wissen, dass wir kurz vor dem Kollaps stehen. Jedes Haus ist jetzt auf sich allein gestellt. Nach dem Motto: Kümmert euch selbst irgendwie. Ein super Plan ist das!“
Wer sich heute mit Corona infiziert und schwer erkrankt, der landet erst nach Wochen auf der Intensivstation. Denn das Virus braucht Tage, um sich im Körper auszubreiten. Wer krank wird, liegt erst einmal zu Hause im Bett, bevor er merkt, dass er Hilfe braucht.
Im Krankenhaus kommen die Menschen zunächst auf eine normale Station, erhalten Sauerstoff, und erst dann geht es für einige weiter auf die Intensivstation. Einige andere müssen direkt auf der Intensivstation aufgenommen werden: Sie leiden an Luftnot, die Atemfrequenz ist stark erhöht.
Auf der Intensivstation kann man Tag für Tag beobachten, was Sars-CoV-2 im menschlichen Körper anrichtet. Hier gehört es zur Arbeit, dem Erreger ausgesetzt zu sein – so nah wie nirgendwo sonst. Julia Kompatscher ist Intensivmedizinerin auf der neuen Covid-Intensiv-station am Krankenhaus Bozen. Einen Teil der Woche arbeitet sie dort, einen Teil an der Universitätsklinik Innsbruck, wo sie seit 2013 tätig ist.
Als sie zu Beginn der ersten Corona-welle im Frühjahr nicht mehr über die Brennergrenze nach Innsbruck kam, entschied sie sich kurzfristig, im eigenen Land mitzuhelfen. Sie hat Tage erlebt, an denen fünf, sechs Patienten innerhalb weniger Stunden intubiert werden mussten und ständig neue Corona-Patienten eingeliefert wurden.
In den Wintern davor hatte die 37-Jährige oft auch Patienten mit Grippe auf der Intensivstation betreut – mit Covid-Patienten sei das aber nicht zu vergleichen, sagt sie. Und: „Mittlerweile kennen wir das Krankheitsbild etwas besser. Studien helfen uns, gezielte Therapiestrategien zu verfolgen. Eine durchbrechende, kausale Therapie gibt es noch nicht – was aber generell bei viralen Erkrankungen der Fall ist.“
Zwölf Stunden dauert ein Dienst auf der Covid-Intensiv. Bevor es losgeht, muss man in die Intensiv-Uniform steigen: spezieller Kittel, Maske, Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille, Kopfbedeckung. Bald schon fängt man an zu schwitzen, fühlt sich wie in einer Sauna. Das macht die Arbeit auf einer Covid-Intensiv besonders anstrengend, auch wenn man sich, so Kompatscher, „schon fast daran gewöhnt hat“. Nach einigen Stunden wechselt man sich ab: „Damit wir was trinken, auf die Toilette gehen und uns etwas ausruhen können.“
Die Arbeit an Covid-Patienten ist anspruchsvoll, körperlich, medizinisch und pflegerisch. Die vielen Überwachungsmonitore und Geräte müssen bedient, der Kranke richtig gelagert werden. Wer auf der Intensiv liegt, muss engmaschig betreut werden, rund um die Uhr, 24 Stunden. „Ein Intensivpatient ist so fragil, dass es oft nur Kleinigkeiten braucht, damit alles aus dem Gleichgewicht kommt“, sagt Julia Kompatscher. Es braucht Ärzte und Pflegekräfte, die wissen, wie man ein Beatmungsgerät bedient, die alle Warntöne kennen, die also dafür ausgebildet sind. Davon gibt es zurzeit nicht gerade viele. Das Problem ist überall dasselbe: Nicht die technische Ausstattung ist das Problem. Es ist der Mangel an qualifiziertem Personal.
„Die intensivmedizinische Ausbildung dauert mehrere Jahre“, sagt Kompatscher. „Viele verstehen immer noch nicht, dass man auf Intensiv nicht irgendjemanden hineinstellen kann und glaubt, dass der dann in drei Monaten eingelernt ist.“
Mit Personal aus anderen Abteilungen aufstocken – das musste man im Frühjahr tun, und jetzt wieder. Das normale Krankenhaus-Programm wurde dafür im ganzen Land heruntergefahren, viele planbare OP-Eingriffe werden verschoben, die Arbeit in den Ambulanzen nahezu ausgesetzt. Viele fachfremde Pfleger und Ärzte müssen jetzt auf den Covid-Normal- und Covid-Intensivstationen mithelfen. Wer sich nicht freiwillig gemeldet hat, wurde zwangsverpflichtet. Einschulungen haben nicht alle erhalten.
Das Problem, auf das einige Ärzte im Gespräch mit ff hinweisen: Die anderen Krankheiten bleiben nicht stehen. „Die Kollateralschäden“, so die Sorge vieler, „werden immens werden. Sehr vieles konzentriert sich nur noch auf Corona.“ Vor allem aus dem Landeskrankenhaus Bozen hört man besorgte Stimmen, dass das Haus nicht mehr imstande sei, dem Versorgungsauftrag gerecht zu werden. In Normalzeiten sind bis zu 13 Operationssäle in Bozen in Betrieb, zurzeit sind es gerade einmal vier.
Einige kritisieren, man hätte das Landeskrankenhaus so gut wie möglich covid-frei halten müssen, damit die Spezialabteilungen, die es nur hier gibt, halbwegs normal weiterarbeiten könnten. Die peripheren Häuser hätten in der ersten Welle bewiesen, welch gute Arbeit sie an Covid-Patienten zu leisten imstande sind. Man hätte diese für die zweite Welle stärken und aufbauen müssen. Das sagen Ärzte sowohl vom Landeskrankenhaus als auch von peripheren Häusern.
Spricht man Florian Zerzer, den Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, auf die schwierige Versorgungslage an, erzählt er von den Vorbereitungsarbeiten in den Sommermonaten. Man habe Beatmungsgeräte angekauft, zusätzliche Betten aufgebaut, Personal eingeschult und auch versucht, neues Personal einzustellen. „Nur für die aufgestockten Intensiv-betten bräuchten wir 30 Ärzte und 150 Pflegekräfte. Diese zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit.“ Der Generaldirektor weiß, dass das Personal müde ist. „Die Belastung für Ärzte und Pflegepersonal“, sagt er, „ist seit dem Frühjahr extrem hoch. Stress, Druck, Angst, sich selbst zu infizieren – all das trägt nicht zu einer hohen Motivation bei.“
Seit einem Monat wechseln er und Gesundheitslandesrat Thomas Widmann sich darin ab, medial zu betonen, dass der Spielraum im Gesundheitssystem nicht mehr groß sei. Dass der Sanitätsbetrieb an seine Grenzen stoße. Dass der Druck auf die Krankenhäuser zunehme. Jeden Tag frühmorgens sitzen die beiden mit den Vertretern der Covid-19-Taskforce zusammen, um die nächsten Schritte zu besprechen.
Jeder Tag wird begleitet von der Ungewissheit, wie es in den Krankenhäusern weitergeht. Kommt man an den Rand der Kapazität? Wie viele Patienten müssen heute wieder aufgenommen werden? Woher bekommt man die nötigen Blutreserven? „Dieser ständige Druck ist eine große Belastung“, sagt Florian Zerzer. Im Team schaffe man es, sich gegenseitig zu stärken. „Alleine wäre man nichts. Nur gemeinsam können wir es schaffen.“
Julia Kompatscher hat sich für die Intensivmedizin entschieden, weil sie akute, komplexe Krankheitsfälle reizen. Ihr gefällt die kontinuierliche Betreuung von Patienten sowie die Arbeit im Team. „Man schaut sich jeden Patienten gemeinsam an, bespricht die Therapiestrategie – das ist toll“, sagt sie. Und auch das derzeitige Arbeiten mit Kollegen aus den unterschiedlichsten Häusern im Land sei „sehr bereichernd“.
Irgendwann beginnt die junge Ärztin auch über das zu sprechen, was ihr Angst macht. An die Grenzen zu kommen. „An den Punkt zu kommen, wo die eigene Kraft nicht mehr vorhanden ist. Und wo man sich entscheiden muss: Wen kann ich noch intubieren? Wem kann ich noch ein Intensivbett geben – und für wen habe ich keines mehr?“ Bei der ersten Welle sei man davongekommen. Aber das heiße nicht, dass es nicht doch noch einmal so weit kommt.
In der Notfallmedizin heißt das Triage. Die Patienten zu sortieren – nur wer eine realistische Chance auf Heilung hat, wird noch behandelt. In Südtirol waren das bislang nur theoretische Überlegungen. Angesichts der Pandemie werden sie plötzlich konkret.
Wie also umgehen mit der ethisch heikelsten Frage dieser Coronakrise? „Man hofft natürlich, dass es nie zu so einer wahnsinnig belastenden Situation kommt“, sagt Herbert Heidegger. Trotzdem sei bereits im Frühjahr in verschiedenen Kommissionen darüber diskutiert worden, auch im Südtiroler Landesethikkomitee.
Heidegger ist Gynäkologie-Primar und Sanitätskoordinator am Krankenhaus Meran sowie Präsident des Landesethikkomitees. Im Idealfall, sagt er, treffe ein Team die Entscheidung mit dem Patienten gemeinsam oder seinen Nächsten. Es gelte das „Mehraugenprinzip“. Die Fragen dabei seien: Braucht dieser Mensch eine intensivmedizinische Behandlung? Wenn ja: Wie hoch ist die Erfolgsaussicht? Liegt eine Patientenverfügung vor? „Bei allem, was man als Mediziner tut“, sagt Heidegger, „auch unabhängig von einer Triage, geht es um zwei Fragen: Macht das, was wir tun, Sinn? Und: Was will der Patient?“
Herbert Heidegger sagt, man müsse alles unternehmen, damit eine Triage nicht verfrüht zum Einsatz komme. Vielmehr müsse man im Team gemeinsam vorgehen, miteinander kommunizieren, die Dinge gut dokumentieren, Entscheidungen überprüfen, Nachbesprechungen führen. „Solche Situationen sind eine große psychische Belastung für alle Beteiligten“, sagt er. „Es gilt auch, den moralischen Distress für Mitarbeiter möglichst gering zu halten.“
Jetzt gehe es vor allem darum, die Zahl der Infizierten so weit zu senken, dass es keine Triage braucht. „Natürlich ist man höchst angespannt. Aber ich persönlich glaube immer noch, dass wir die Kurve kriegen.“ Es ist ein Freitag Mitte November, insgesamt müssen an diesem Tag 41 Patienten auf den Intensivstationen des Landes betreut werden.
Einige Tage später wird Julia Kompatscher, die Intensivmedizinerin, davon erzählen, dass sich die Intensivstationen zwar weiterhin füllen, aber langsamer als vor zwei Wochen befürchtet. „Die Situation ist stabil, aber sehr ernst“, sagt sie. Täglich würden Betten wieder frei – weil sich Covid-Patienten entweder erholt hätten oder leider verstorben seien. Fast zeitgleich aber stünden bereits Patienten von der Normal- oder Subintensivstation an, weil sie intensivpflichtig werden. Noch, sagt die Ärztin, könnten alle Patienten adäquat versorgt werden. „Das gesamte Intensivpersonal leistet zurzeit 200 Prozent seiner eigentlichen Arbeit, um dies alles zu ermöglichen. Krankheitsfälle in den eigenen Reihen erschweren die Situation zusätzlich.“ Jeder versuche, alles zu mobilisieren, was gehe. „Aber den ganzen Winter über halten wir das nicht aus.“
Auch Alex Hofer*, der Intensiv-mediziner in der Peripherie, spricht zu diesem Zeitpunkt von einer „stabilen, aber sehr angespannten Situation“. „Ein Tsunami wie im März ist bislang zum Glück ausgeblieben. Auch wenn immer wieder sehr schwer Kranke eingeliefert werden.“ Aber da sind auch die guten Nachrichten, die Hoffnung geben: Patienten, die genesen, selbst nach schwersten Krankheitsverläufen.
Othmar Bernhart, der Medizin-Primar, hat langsam das Gefühl, an die Grenze seiner Kraft zu kommen. Dabei war er in jungen Jahren mal Marathonläufer. In der ersten Welle, sagt er, sei man knapp vor einer Triage-Situation gestanden. Und heute? „Ich habe keine Möglichkeit mehr, etwas zu erweitern. Wenn wir belegt sind, sind wir belegt.“ Im Moment habe sich die Situation
stabilisiert. Es herrsche „eine trügerische, ja, unheimliche Stille“. „Aber ich glaube nicht so recht daran, dass es vorbei ist.“
*Name von der Redaktion geändert
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

Der Teufel steckt im Detail
Mit der Massentestung hat Südtirol Geschichte geschrieben. Aber um daraus wirklich ein Modell für die Bekämpfung der Pandemie zu machen, braucht es noch Geduld.
-

Ärzte auf Abwegen
Jenseits des Brenners: (ul) Es ist nicht lange her, da flogen Patienten aus dem ganzen Nahen Osten in den Libanon. Dort erwarteten ...


















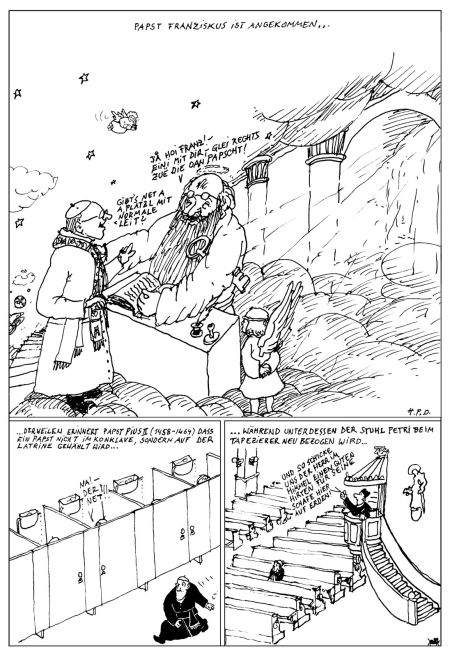





Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.