Sachbuch – Demokratie
Gesellschaft & Wissen
Den Tod vor Augen
Aus ff 03 vom Donnerstag, den 21. Januar 2021

Corona hat Daniel Bedin, 47, voll erwischt. Er hat 22 Tage im Krankenhaus verbracht, 10 davon auf der Intensivstation. Er ruft dazu auf: „Lasst euch impfen!“
Ich werde das nie vergessen“, sagt der Mann und wischt sich eine Träne aus den Augen. Ein dicker Schlauch führt in seine Nase, er leitet Sauerstoff in die geplagte Lunge. Der Mann heißt Daniel Bedin. Er ist 47 Jahre alt, Abteilungsdirektor beim Land und kommt aus Andrian.
Es ist der 6. Januar, als Bedin dem Filmemacher Andrea Pizzini ein Kurzinterview gibt. Es dauert zwei Minuten und dreizehn Sekunden – und ist ziemlich beeindruckend.
Gezeigt wird ein Mensch in den mittleren Jahren, dem Covid-19 sehr stark zugesetzt hat. Seine Stimme bricht ständig, er wirkt kraftlos und niedergeschlagen. Und er hat eine Botschaft: Unterschätzt das Virus nicht, lasst euch impfen!
Pizzini ist seit Anfang Dezember immer wieder in der Bozner Intensivstation, er macht Filmaufnahmen und führt Interviews. Die Pandemie, sagt er, sei ein Jahrhundertereignis. Das möchte er mit seinem Projekt „Wellenbrecher“ dokumentieren. Neben den Videos auf Facebook und Youtube ist auch ein längerer Film geplant, der im Laufe des Jahres in Südtirol ausgestrahlt werden soll.
Doch zurück zu Daniel Bedin. Am Samstag vergangener Woche konnte er das Bozner Krankenhaus nach 22 Tagen wieder verlassen. 10 Tage davon verbrachte er auf der Intensivstation. Am Montag dieser Woche fühlte er sich wieder so weit hergestellt, um diesem Magazin seinen beinharten Kampf mit dem Tod zu schildern:
„Als ich am Samstag nach Hause gekommen bin, habe ich zuerst meine Frau und die beiden Töchter, 16 und 11, in die Arme geschlossen. Endlich konnte ich sie wiedersehen, endlich war ich wieder daheim!
Während meines Aufenthalts im Krankenhaus gab es auch Momente, wo ich daran gezweifelt habe, dass ich das überstehe. Zum Beispiel als ich zur Computertomografie musste, zum Tac, wie man so schön sagt. Ich hatte die Sauerstoffmaske auf, die man auf dem Foto sieht. Auf einmal musste ich derart stark husten, dass ich keine Luft mehr bekam. Ich weiß noch, wie die Ärztinnen und Pfleger diskutiert haben, aber dann reißt der Film.
Das war ein ,zacher‘ Moment. Ich habe mich verloren gefühlt. Ich dachte, diesmal wird es eng, diesmal könntest du den Kampf verlieren. Das war eine Erfahrung, die sich nur schwer in Worte fassen lässt.
Aber ich bin wieder zu mir gekommen. Nun bin ich überzeugt, dass jemand oder etwas wollte, dass ich hierbleibe. Bei meiner Familie. Was genau dieser Jemand oder dieses Etwas war, weiß ich aber nicht.
Wie ich mich infiziert habe? Das ist unklar. In der Schule meiner Tochter hat es einen Fall gegeben, die Kinder mussten daraufhin daheim in präventiver Quarantäne bleiben. Meine Frau arbeitet im Kinderhort, auch dort gab es einen Fall, sie musste ebenfalls präventiv zu Hause bleiben. Ich selbst bin als Abteilungsdirektor beruflich viel unterwegs, habe also auch viele Kontakte. Daher kann ich auch eine Infektion über diesen Weg nicht ausschließen.
Kurzum: Ich hatte am 21. Dezember die ersten Symptome und war am 26. Dezember in der Intensivstation. Das ist wahnsinnig schnell gegangen. Und das obwohl ich ein sportlicher Mensch bin: Ich absolviere Bergläufe, gehe vier- bis fünfmal die Woche laufen, halte mich fit. Ich rauche nicht, ich trinke ab und zu ein Glas Wein, nicht mehr. Ich glaube, sehr gesund zu leben.
Dass es genau mich erwischt hat, ist unglaublich. Die Ärzte sagen, einen echten Grund dafür gebe es nicht, Corona sei wie russisches Roulette. Die meisten kommen ungeschoren oder glimpflich davon, einige wenige trifft es dafür umso härter.
Wir waren alle vier positiv, die Frau, die Kinder, ich. Sie hatten ein wenig Fieber und Geschmacksverlust, aber das war nach drei, vier Tagen wieder besser.
Bei mir hat sich die Lage hingegen verschlechtert. Am Weihnachtstag habe ich auf einmal gemerkt, dass ich nicht mehr richtig atmen kann. Meine Frau hat sofort die Rettung gerufen, die mich ins Krankenhaus gebracht hat.
Dort haben sie mir Sauerstoff gegeben. Trotzdem ist meine Atmung von Minute zu Minute schlechter geworden. Am nächsten Tag haben sie mich auf die Intensivstation verlegt.
Auf der Intensivstation war ich der Einzige, der bei sich war. Die Ärzte haben bei mir versucht, die Kraft des Sportlers auszunutzen, nicht zu massiv mit Maschinen und Technik einzugreifen. Sie haben gesagt, wenn ich es mit der Sauerstoffmaske schaffe, also ohne Schläuche in die Lunge, geht es auch mit der Genesung viel rascher.
Wenn ich nun höre, dass jemand sagt, Covid-19 sei nur eine Grippe, dann kann ich nur verständnislos den Kopf schütteln. Diese Leute sollten einmal eine Runde in so einer Intensivstation machen müssen, damit sie sehen, wie es dort zugeht. Dann würden sie endlich aufwachen. Mir braucht jetzt keiner mehr zu erzählen, dass es das Virus nicht gebe oder dass die Pandemie nur erfunden wäre. Ich bin zehn Tage auf der Intensivstation gelegen, mehr tot als lebendig.
Wenn ich Ihnen das erklären darf: Es fühlt sich an, als hätte man eine Nylontüte über den Kopf gestülpt, und zugleich hält jemand fest die Gurgel zu. Und man versucht zu atmen, doch es geht nicht oder nur ganz, ganz schwer. Zehn Tage lang. Das war eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche – und die ich nie vergessen werde.
Als Führungskraft des Landes bin ich es gewohnt, die Dinge aus einer umfassenderen Perspektive zu betrachten. Objektiv, soweit das möglich ist. Daher ist mir klar, dass der Verlauf der Krankheit normalerweise relativ unspektakulär abläuft. Bei den meisten. Aber es gibt auch Menschen, bei denen die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt. Und das sind nicht nur die Alten, in der Intensivstation sind Junge genauso wie Alte.
Das Problem ist die Anzahl. Als ich in der Intensivstation war, waren 23 Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Das sind nicht wenige. Aber was passiert, wenn da noch weitere 10 dazukommen? Oder 20? Dafür fehlt dann der Platz, es fehlt das Personal, um diese Kranken zu betreuen. Daher kann ich nur alle vor dieser Krankheit warnen.
Jetzt gibt es die Impfung. Die sollten alle in Anspruch nehmen, die es können. Das ist eine Bürgerpflicht. Wir leben zusammen in einer Gesellschaft, da muss jeder Verantwortung zeigen. Für mich ist es völlig unverständlich, dass jemand eine Impfung verweigert.
Wie gesagt: Ein Rundgang auf so einer Intensivstation würde vielen Menschen die Augen öffnen. Was ist ein kleiner Pikser gegen so einen Leidensweg?
Wie es nun weitergeht? Die nächsten zwei Wochen werde ich sicher zu Hause bleiben müssen. Ich bin ständig mit den Ärzten in Kontakt, mal sehen, wie es mit dem Gesundwerden voranschreitet. Ich war fast einen Monat im Bett, habe nicht viel gegessen. Ich muss erst wieder zu Kräften kommen.
Auch mental muss ich mich erst noch erholen. Die Intensivkräfte sagten zu meiner Frau am Telefon, sie seien es nicht gewohnt, mit den Patienten zu sprechen. Normalerweise liegen sie in einem künstlichen Koma. Ich war im Gegensatz dazu teilweise wach und habe viele Dinge auf der Station mitbekommen. Die Krise des Nachbarn auf der linken Seite, den Schüttelfrost von jenem auf der rechten Seite. Das muss ich erst noch verarbeiten.
Die Arbeit der Ärztinnen und Pfleger im Krankenhaus ist unglaublich. Als es mir ein wenig besser gegangen ist, haben sie sich mit mir ein wenig unterhalten. Sie haben mir vom Druck berichtet, dem sie ausgesetzt sind, vom Arbeitspensum, vom Personal- und vom Platzmangel. Da kommt ganz schön viel zusammen.
Also: Hut ab vor diesen Menschen, sie verdienen unseren Respekt und unseren Dank.“
Notiert von: Karl Hinterwaldner
Weitere Artikel
-

-

Impfen? Oder nicht impfen?
Wenige Impfdosen, viele Impfkritiker: Warum der Kampf gegen Covid-19 noch lange nicht entschieden ist.
-

„Ach, wie schreibt ihr schlecht“
Es ist die wichtigste Seite eines Magazins: das Cover. Eine Titelseite hat viele Aufgaben, sie muss Inhalte transportieren. Lust auf mehr machen. Zum ...
















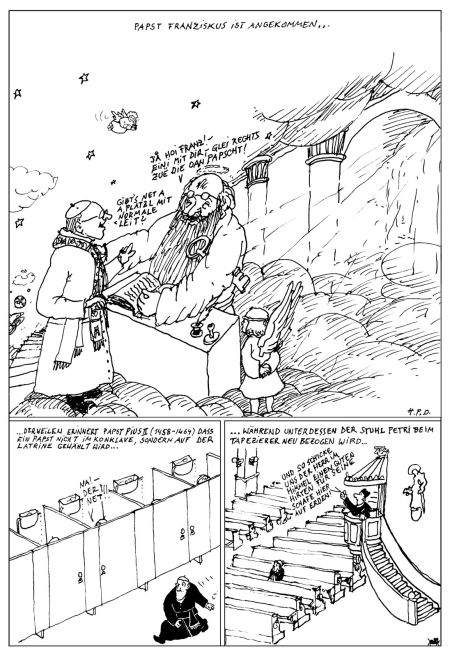





Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.