Der Historiker Hans Heiss, 68, entstammt einer Gastwirtsdynastie. Er sagt, Familienbetriebe seien „ein gesellschaftlicher Mehrwert“. Wie sie entstanden sind. Und was sie auszeichnet.
Gesellschaft & Wissen
Ein Land hält den Atem an
Aus ff 09 vom Donnerstag, den 04. März 2021

Zwischen Kriegsende, Annexion und faschistischer Machtergreifung: Der Historiker Hannes Obermair beleuchtet die Zeit von 1918 bis 1922 in Südtirol. Ein Vorabdruck.
In seinem Jahrhundertroman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ entfaltet Marcel Proust das berühmte Bild einer Erinnerungsauferstehung aus einem Stück Gebäck, das in den Tee getaucht wird. Das „unermessliche Gebäude der Erinnerung“ wird vom Geschmack einer einzigen kleinen Madeleine hervorgerufen, und vor den Augen des Erzählers steigen „die Leutchen aus dem Dorfe und ihre kleinen Häuser und die Kirche und ganz Combray und seine Umgebung, alles deutlich und greifbar, die Stadt und die Gärten“ wie eine Fleisch gewordene Gegenwart wieder auf (Proust 1978, 65–66).
„Und dann mit einem Male war die Erinnerung da“ – beinahe so will es uns rund um das Centenaire von 1920 ergehen. Lange vergessen und aus der Südtiroler regionalen Perspektive in gewisser Hinsicht verdrängt, ist die kurze Jahresspanne der Zeit nach Versailles und vor der faschistischen Machtübernahme als große verpasste Chance demokratischer Neuerfindung, aber auch als faktische Transitionsphase am Vorabend des Totalitarismus fast gänzlich aus dem Blickfeld historisch-kulturwissenschaftlicher Betrachtung geraten. Doch bekanntlich kehrt das Verdrängte zumeist machtvoll zurück. Erst jüngst sind zwei umfangreiche Regionalstudien erschienen, die das Potenzial einer Neubetrachtung dieser Zwischenjahre ebenso klug wie ertragreich ausschöpfen (Überegger 2019; Rina-Rieder 2020). Beiden Publikationen, die ganz unterschiedliche Zugangsweisen wählen, ist gemeinsam, dass sie ihren Anker im Niemandsland zwischen einem „Nicht mehr“ und einem „Noch nicht“ auswerfen.
Im Ersten Weltkrieg – dem nicht zu Unrecht als Großen Krieg bezeichneten Massenkonflikt mit weit über zehn Millionen Toten und bis dahin nicht vorstellbaren Zerstörungen und Verlusten – verdampfte mit den habsburgischen Ordnungen auch die österreichische Zugehörigkeit der tirolischen Gebiete südlich des Brenners. Über Jahrhunderte hatten diese die Entwicklungswege der „Casa d’Austria“ geteilt und mitgestaltet und waren eine zentrale Klammer der transalpinen Waren- und Menschenströme dies- und jenseits von Brenner und Reschen gewesen.
Mit dem Geheimvertrag von London von 1915 war die Angliederung des „zisalpinen Tirols“ an das Königreich Italien diesem ganz entgegen den sprachpolitischen Verhältnissen im Falle des Kriegseintritts an der Seite der Alliierten zugesichert worden. Nach dem Sieg der Koalition gegen die Mittelmächte führte dieses Versprechen zum Schaden Dritter nicht nur zur tirolischen Teilung, sondern geriet zugleich auch zur unfreiwilligen Geburtsstunde von Südtirol als einem präzise umschriebenen Raumkonstrukt beziehungsweise einem – wie es Hans Karl Peterlini treffend bezeichnet – „jungen Lande“ (Peterlini 2012).
Entgegen landläufigen Vorstellungen ist die heutige Autonome Provinz Bozen-Südtirol tatsächlich eine relativ rezente Konstruktion, hervorgegangen aus einer zur weitgehenden Disposition stehenden Masse eines europäischen Konkurses (Grote-Obermair 2017). Auf einer fiktiven mitteleuropäischen Menükarte ist damit „Südtirol“ stets auch ein etwas flottierender Signifikant geblieben, und es lohnt sich daher, dieses eigentümliche Monopoly unter neuen Fragestellungen zu betrachten. Dies ist im Kern die Absicht dieses Sammelbandes, der mehrere Beiträge zusammenführt, die die „Jahre dazwischen“ einzuordnen versuchen, ohne zugleich der Versuchung zu erliegen, von der Zwangsläufigkeit von tatsächlich eingetretenen Entwicklungen auszugehen.
Die Jahre rund um 1920 als Jahre eines Übergangs zu betrachten – dies war die thematische Zentrierung, die den Schreibenden vorlag. Zu Recht ist von einem so aufmerksamen Intellektuellen wie Helmut Dubiel bemerkt worden, die Rede von einem Übergang verberge immer auch das Eingeständnis, dass „die gesellschaftliche Entwicklung einerseits Symptome hervorbringt, die sich den herkömmlichen Diagnosen entziehen, andererseits das beschworene Neue jedoch noch nicht die Prägnanz eines benennbar ‚neuen‘ Paradigmas erreicht hat“ (Dubiel 1985, 7).
Italien war nach 1919 beileibe kein failed state, wiewohl die von den Hauptsiegermächten auf den Friedensverhandlungen von Versailles eingeräumten Kompensationen für den italienischen Kriegseintritt zu erheblicher nationaler Missstimmung führten (Gernert 2016, 396f). Weder war der Kolonialbesitz vergrößert, noch waren die zunächst zugesicherten Gebietserweiterungen am Balkan erlangt worden. Die Gewinnung der tirolisch-trentinischen Gebiete südlich des Alpenhauptkamms war aus dieser Perspektive nichts als eine geopolitische Minimalsatisfaktion.
Jedoch konnten die bloß reduzierten Geländegewinne, aber auch das eher dümpelnde internationale Prestige Italiens das Entstehen autoritärer Tendenzen nicht verhindern – sie stellten vielmehr, ähnlich der Weimarer Republik, den idealen Bodensatz für die Eskalationsbereitschaft militanter Gruppierungen dar (Corni 2020). Die Freischärler-Aktion Gabriele D’Annunzios in Rijeka/Fiume 1919 sowie die aggressiven antislawischen Unruhen in Triest 1920 mit der Zerstörung des slowenischen Kulturzentrums und zahlreichen politisch motivierten Morden verdeutlichen unübersehbar, wie sehr der öffentliche Raum zum Kampfplatz neuer Herrschaftsformen aufrückte (Kneipp 2018; Wörsdörfer 2004).
Die Gewaltbereitschaft war in den multiethnischen Grenzregionen merklich gesteigert. Nicht nur trat hier der zivilgesellschaftliche Mangel an kultureller Duldsamkeit auf besondere Weise hervor, er wurde noch gesteigert von gegenseitigen Superioritätshaltungen, die den Anlass zum Zwist förmlich suchten (Gatterer 1968; Cattaruzza 2003). Gleichsam am Nullpunkt seines gesellschaftlichen Seins war das junge Südtirol der Zeit um 1920 aber auch von neuen Hoffnungen getragen, die unter anderem in den Autonomie-
entwürfen des Deutschen Verbandes und der Sozialdemokratischen Partei Ausdruck fanden.
Neben die Kriegsfolgentraumata trat eine Erwartungshaltung, der endlich eingekehrte Friedenszustand möge trotz ungeliebter neuer staatlicher Zugehörigkeit auch positive Optionen des Fortkommens bieten. Diese Phase diente darum auch dazu, neue Narrative und Selbstbilder zu entwerfen, und das Lemma Südtirol füllte sich überhaupt erst unter dem Druck der Abgliederung und der neuen staatlichen Zugehörigkeit mit Inhalten (Heiss 2000).
Es geht hier also um die spezifische Zeiterfahrung von 1920, um Erwartungshorizonte und Erfahrungsräume der seinerzeit im Südtiroler Raum lebenden Menschen und um ihr besonderes Verhältnis zur eigenen historischen Zeit (Koselleck 2020). Was war ihnen bewusst, was konditionierte sie, welche sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnisse orientierten ihr Handeln oder gestalteten zumindest ihre Praxis?
Gewiss überfiel sie, zumindest aus der Perspektive der deutsch- und ladinischsprachigen Mehrheitsbevölkerung, eine Fremdheitserfahrung, die man näherhin als Angst und Zukunftssorge beschreiben könnte. Die doppelte Stresserfahrung von Kriegsniederlage und staatlichem Herkunftsverlust beziehungsweise Besitzwechsel wurde wohl nur partiell aufgewogen durch das hohe Gut des Friedens, als so wünschenswert der Zustand des Kriegsendes auch empfunden werden mochte. In das Bewusstsein des unwiderruflichen Abschieds vom Elternland schlichen sich vermutlich Abstiegs- und Deklassierungsängste. Das Königreich Italien seinerseits war kaum vorbereitet auf den Territorialgewinn, seine föderalistischen Neigungen nicht vorhanden; Garantien für ethnische Minoritäten waren nicht vorgesehen und nicht gewünscht (Gehler 2008, 66–67).
Weder der neue Nationalstaat mit seinem Uniformierungsdruck noch auch die anderssprachige und kulturell differente Grenzbevölkerung war auf transkulturelle Erfahrungen vorbereitet. Diese erschienen beiden nicht als Chance, vielmehr als zu bannendes Gefahrenszenario. Das waren denkbar schlechte Voraussetzungen für die Entfaltung einer Zivilgesellschaft, und nur wenige hellsichtige Zeitgenossen wie etwa die Sozialisten (und Antifaschisten) Gaetano Salvemini und Wilhelm Ellenbogen diagnostizierten die politische Ökonomie ihrer Gegenwart auf nüchtern-hellsichtige Weise (Pecora 2012; Pallaver 2014).
Zugleich ist die Zeit, deren Betrachtung dieser Band gewidmet ist, von der Erfindung neuer Narrative geprägt, die bis in unsere Gegenwart reichen. Dies ist nicht untypisch für eine Phase, die man als gesellschaftliche Entropie bezeichnen könnte. Die Jahre nach 1918/19 musste man geradezu als Zustand zunehmender Unordnung und Zufälligkeit empfinden. Nicht nur war die Kriegserfahrung allgegenwärtig, nicht zuletzt in den versehrten und unvollständigen Familien – auch die pandemische Influenzawelle von 1918 bis 1920 schuf eine omnipräsente Todesnähe, der die vielfach unterernährten Menschen hilflos gegenüberstanden (Spinney 2018).
Mit einer biologischen Metapher werden 1919/20 im Alttiroler Raum getrennte Körper geschaffen, die seither mit gesellschaftlichen Phantomschmerzen kämpfen. Im öffentlichen und im privaten Narrativ wird die erlittene Annexion zur eigentlichen moralischen Ressource der Entität Südtirol. Eigentlich von den Akteuren nicht wirklich gewollt, gerät die neue Raumeinheit unter der Hand zum identitätsstiftenden Horizont. Diese Kehre und Umwertung bedarf des immerwährenden Opferdiskurses und bildet – bis in die Gegenwart – den Rahmen des politisch Sagbaren und militant zu Verteidigenden.
Jegliches Südtiroler Kollektivdenken bezieht seine Ursprungslegitimation aus den Jahren 1919/20. Die Erbsünde einer Geburt aus der Kriegsniederlage liefert so unablässig jenes moralische Kapital, das als ethnopolitischer Kitt funktional ist für die politische Versäulung und den reaktionären und antipluralistischen Grundtenor der regionalen Gesellschaft (Kruijt/Goddijn 1965; Foucault 2003). Vor diesem Hintergrund lohnt der Blick auf die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und vor der Machtübergabe durch den italienischen Faschismus. Die zeitliche Perspektivierung auf diese Zwischenjahre legt Motive offen, die weit über den historischen Moment hinausreichen und den Charakterzug einer Neuformation tragen (Payk-Pergher 2019).
Zu den wirkmächtigsten identitären Neuentwürfen zählen neben der Rede vom Südtiroler Volk insbesondere die zunächst unerfüllt gebliebenen Autonomieprojekte. Ihr bestimmender Subtext ist die ambivalente Ethnogenese unter fremdbestimmten Bedingungen, auch der unausgesprochene Traum einer autarken und selbstgenügsamen Splendid Isolation. Dieses Narrativ drang unauslöschlich in die offiziösen und offiziellen öffentlichen Diskurse ein, die zum Kernbestand der Südtiroler Meistererzählung zählen: Das „Land in Not“ wird zum Leitmotiv einer dauernden Anspruchshaltung und Anwartschaft auf Kompensation. Vermutlich ist dies eine sozialpsychologisch effiziente Bewältigungsstrategie jener konstitutionellen Asymmetrie, die mit der Angliederung an Italien einherging.
Zugleich aber ist dieses defensive Momentum kein brauchbares Teil im Bausatz einer funktionierenden Zivilgesellschaft, deren Genealogie in letzter Instanz prekär bleibt und die darum dazu neigt, jede abweichende Meinung umweglos zum Dissens zu erklären.
weitere Bilder
Das Buch: In „Die Zeit dazwischen | Il tempo sospeso“, herausgegeben von Ulrike Kindl und Hannes Obermair, wird die Zeit von 1918 bis 1922 in Südtirol beleuchtet (Edizioni alphabeta Verlag).“ Ein kritischer Blick zurück“, so die Herausgeber, „könnte hilfreich sein, der im Großen und Ganzen segensreichen Autonomie-Lösung einen weiteren Impuls zu geben, um das Land mit seiner schwierigen Geschichte auszusöhnen.“
Weitere Artikel
-

-

-

Ich habe Angst
ff 8/21 über eine Jugend, die mitten im Aufbruch von einem Virus eingebremst wird




















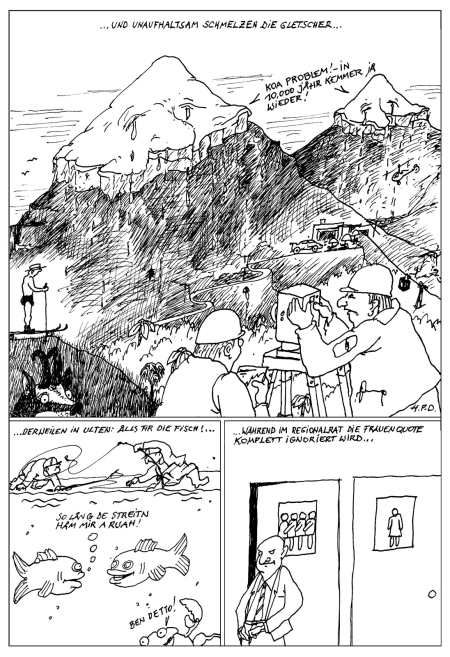






Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.