Südtirol ist ein Tourismusland. Kamen 1960 noch 713.000 Gäste zu uns, sind es heute mehr als zehnmal so viele. Und es werden immer mehr.
Kultur
Spannendes für den Pool
Aus ff 31 vom Donnerstag, den 01. August 2019
Die ff-Redaktion empfiehlt ihre liebsten Bücher – lesbar zu Hause, auf einer Alm oder wo auch immer.
Nichts für Depressive
Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich umzubringen? Nein? Dann könnte „Serotonin“ von Michel Houellebecq der Anstoß dafür sein. Der Starautor erzählt in seinem Roman die Geschichte eines 46-jährigen Beraters des Ministeriums für Landwirtschaft, der beschließt, sich aus seinem Leben zu verabschieden. Er kündigt seinen Job, beendet die Beziehung mit seiner japanischen Freundin und löst seine Wohnung auf. Bei all dem hilft ihm ein Antidepressivum, das dem Buch den Namen gibt. Houellebecq-Neueinsteiger werden mit „Serotonin“ ihre Freude haben, das Werk ist so herrlich morbide und depressiv wie seine Vorgänger. Jene, die „Ausweitung der Kampfzone“ und „Elementarteilchen“ kennen, bleiben hingegen traurig und auch ein bisschen ratlos zurück. Aber genau darauf zielt der Autor ab. Trotzdem: Houellebecq wie er leibt und schreibt.
Karl Hinterwaldner
Michel Houellebecq, Serotonin. Dumont 2019, 340 Seiten, 24 Euro.
Der Wilde
Listig, wie Arriaga die Leser gleich zu Beginn in die Irre führt: Da glaubt man bereits zu erfahren, was alles passieren wird: „Im Lauf der kommenden vier Jahre würden alle sterben. Mein Bruder, meine Eltern, meine Großmutter, die Wellensittiche und King.“ Puh, denkt man sich da, warum soll ich mich jetzt durch diesen Schmöker mühen?
Als ich das Buch dann zuklappte, ärgerte ich mich, dass nicht weitere 746 Seiten auf mich warteten. In „Der Wilde“ erzählt Arriaga die Geschichte einer versuchten Zähmung – von Juan, dem Ich-Helden, dessen Bruder Carlos, der schönen Chelo, und von einem Wolf. Die Geschichte spielt in Mexiko-Stadt und irgendwo in der Wildnis von Alaska. Es geht um Träume, Rebellion, Liebe, es geht um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Unterwerfung und Freiheit. Banale Themen eigentlich, die Arriaga mit seiner wunderbaren Sprache in einen spannenden Thriller eingewoben hat, der mich von der ersten bis zur letzten Seite faszinierte und fesselte.
Norbert Dall’Ò
Guillermo Arriaga, Der Wilde. Klett Kotta 2018, 746 Seiten, 26 Euro.
Männer halt
Jahrelang erschien samstags in der Süddeutschen Zeitung die „Männer“-Kolumne der Journalistin und Schriftstellerin Johanna Adorján, bis Ende 2018. Dann, am Ende, ist daraus ein kleines Buch entstanden, mit siebzig dieser Männergeschichten, ein paar sind neu dazugekommen. Glaubwürdig, schonungslos porträtiert Adorján Prominente, Dumme, Lustige, nervige Besserwisser, ehemalige Liebhaber. Der ewige Dauertelefonierer im Zug ist mit dabei, der Vielflieger mit silbrigen Rollköfferchen, und Tim, groß und immer zu nah, in dessen Gegenwart man sich unwohl fühlt. Männer halt, kennt man ja. Das Spektrum an Männern ist breit, gibt es doch so viele und so unterschiedliche. Manche erkennt man wieder, manche verblüffen.
Adorján ist eine feine Beobachterin und hat ein Gespür für die Sprache. Die kurzen Texte sind herrlich böse und witzig zugleich. Und, bitte zu beachten: Unbedingt beide, Mann und Frau, sollten dieses Buch lesen. Männer sollten sowieso mehr Bücher lesen, die von klugen und geistreichen Frauen geschrieben wurden. Umgekehrt passiert das ja schon seit Jahrhunderten.
Alexandra Aschbacher
Johanna Adorján, Männer. Einige von vielen. DTV 2019, 224 Seiten, 18 Euro.
Der dunkle Mann
Ohne Stephen King wüsste heute wohl niemand, mit welcher verschimmelten Marmeladensorte sich an der Wand verspritztes Hirn vergleichen lässt. Unbehagen, Beklommenheit, Wahnsinn: Er malt sie alle, und in welch grellen Farben! Wer sich an dieses Mammutwerk wagt, riskiert, sich völlig in einem Strudel aus Namen und Orten, Handlungssträngen und Gedankenspielen zu verlieren.
In einem amerikanischen Seuchenzentrum kommt ein generiertes Virus frei, das in kürzester Zeit den Großteil der Erdbevölkerung dahinrafft. In der mitten im Alltag erstarrten Welt geistern einige wenige Überlebende umher, getrieben von demselben düsteren Schatten – dem dunklen Mann, einer Schreckensgestalt aus ihren Albträumen. Die einen zieht es in seine Richtung, die anderen organisieren sich, um gewappnet zu sein gegen seine Übermacht.
Die Faszination des Werkes macht Kings Stil aus. Mit hingebungsvoller Liebe zum Detail konstruiert er seine Figuren aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und meuchelt sie dann hinterrücks. Ein groteskes Spiel mit der menschlichen Psyche.
Lisa Fulterer
Stephen King, The Stand – Das letzte Gefecht. Heyne 2016, 1.712 Seiten, 18 Euro.
Im Überwachungsstaat
Überall hängen Bildschirme, die einem das Leben diktieren. Keinen Schritt können die Menschen in Orwells Klassiker „1984“ tun, ohne von den Bildschirmen verfolgt zu werden. Sie sind allgegenwärtig und zeichnen auf, was vor ihnen geschieht und indoktrinieren die Menschen unablässig mit ihren Nachrichten. In heutigen Zeiten dürfte das ein Leichtes sein, in denen das Smartphone ständiger Begleiter ist. Zu Zeiten Orwells, das Buch erschien erstmals 1949, bedurfte es dafür einer großen Portion Imaginationskraft an negativer Utopie. Im Unterschied zu heute setzen sich die Menschen in Orwells Klassiker dem Bildschirm nicht freiwillig aus. Es ist Vorgabe der Regierung, dass in jedem Gebäude so ein Gerät hängt, das die Bevölkerung ständig überwacht und auf Linie hält. Die Welt in „1984“ ist eine dreigeteilte. Ozeanien, Eurasien und Ostasien sind die Machtblöcke, die sich bekämpfen. Ändern sich Bündnisse, wird kurzerhand die Geschichte verändert. Orwells Roman zeigt, wie es ist, in einem Überwachungsstaat zu leben, machtlos zu sein. Orwell zeichnet eine Welt, von der wir heute gar nicht mehr so weit entfernt sind.
Manuel Saxl
George Orwell, 1984. Ullstein 1994, 324 Seiten, 12 Euro.
Fulminantes Debüt
„Etwas zu lieben, heißt in Vietnam, ihm einen derartig schäbigen Namen zu geben, dass es vielleicht unberührt bleibt – und am Leben“. Der junge Autor Ocean Vuong, 31 Jahre, der diesen Satz an einer Stelle seines Debüt-Romans „Auf Erden sind wir kurz grandios“ schreibt, wurde von seiner vietnamesischen Großmutter selbst „Little Dog“ genannt. Vuong umreißt damit die Wunden eines vergessenen Krieges, dessen Druckwellen auch in seiner eigenen Familiengeschichte Spuren hinterlassen haben.
Der Roman ist als Brief eines Sohnes an die vietnamesische Mutter konzipiert, die diesen nie lesen wird (weil Analphabetin), autobiographische Details werden mit erfundenen verwebt. Vuong erzählt eine etwas andere Migrationsgeschichte, eine Geschichte der persönlichen Emanzipation von den Geistern der Vergangenheit. Indem er die Gewalt der Mutter akribisch als vertrackte Form der Zuwendung offenlegt, gelingt es dem Autor, Muster aufzubrechen, Nähe zuzulassen. Stilsichere Bilder, eine berührend verdichtete Sprache und der lyrische Ton machen das Buch zu einem fulminanten Debüt. n
Markus Larcher
Ocean Vuong, Auf Erden sind wir kurz grandios. Hanser 2019, 240 Seiten, 24,20 Euro.
Tiere an der Macht
Die „Farm der Tiere“ – der Titel mutet wie der eines Kinderfilms an. Aber die Tiere auf dieser Farm sind nicht glücklich – sie sind aufwieglerisch. Die Glut der Revolution glimmt so lange in ihnen, bis sie aus den Bauernhoftieren herausbricht und den Bauern und Herren verjagen. Sogleich wird eine Republik der Tiere ausgerufen. In der alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Bald aber stellt sich heraus, dass manche gleicher sind als andere. Es bilden sich Kasten, die Schweine, die Klügsten unter den Tieren, reißen das Kommando an sich und sind in ihrer Hofführung bald nicht mehr vom alten Bauern zu unterscheiden.
Orwell zeichnet in dieser tierischen Versuchsanordnung die Revolution und ihre Folgen als solche und vor allem die Russische nach. Wie Feinde verjagt und Legenden gestreut werden, um einen Kult zu manifestieren. Wie Ausbeutung als Rechtfertigung für ein höheres Ziel dient und wie sich aus einem großen Kreis vieler Gleicher ein kleiner Privilegierter herausschält und die Macht an sich reißt und bindet. Bitterböse Anschauungslektüre. n
Manuel Saxl
George Orwell, Farm der Tiere. Diogenes 2011, 112 Seiten, 9 Euro.
Der neue Reigen
Daniela Krien erzählt leicht, auch wenn sie von Grundsätzlichem erzählt, von Liebe, Sex, Frauen und Karriere, Kindern, die sterben. Im Mittelpunkt stehen Frauen, die versuchen, sich nicht vom Leben, und von den Männern, deformieren zu lassen: Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie sind alle lose miteinander verbunden, tauchen in den Geschichten der anderen auf. Starke Frauen, fragile Welt.
Auf je verschiedene Art dekliniert Krien durch, was Alltag, Verrat, Kinderwunsch und Muttersein bedeuten. Es ist ein unverstellter Blick und eine einfach präzise Sprache. Es steckt viel persönliche Erfahrung in dem Buch, auch wenn es ins Allgemeine ausgreift – Krien (44) muss dem Leben die Zeit zum Schreiben abringen, sie lebt in Leipzig mit einem behinderten Kind. Ein sehr einprägsames Buch.
Georg Mair
Daniela Krien, Die Liebe im Ernstfall. Diogenes 2019, 288 Seiten, 23,50 Euro
Tragische Wahrheiten
Ferdinand von Schirachs Schreibstil ist wie der Titel des Werkes: Einfach, unspektakulär, nüchtern, und oft scheint er unterkühlt. Doch umso spektakulärer sind dafür die Kriminalfälle, die er als Jurist miterlebt hat und von denen seine Kurzgeschichten im Buch handeln. Wie kann es beispielsweise sein, dass eine 17-Jährige von mehreren Mitgliedern einer Blaskapelle auf brutale Art und Weise misshandelt wurde, und am Ende alle Schuldigen freigelassen werden? In allen 15 Geschichten wirft sich irgendwann im Text die Frage um Schuld, Unschuld und Mitschuld auf: Auch wenn man es nicht glauben will, am Ende mancher Geschichten ist man sich nicht sicher, wer der Täter und wer das Opfer ist. Und genau das macht das Buch zu keiner leichten Lektüre: Die Kurzgeschichten sind von sich aus schon sehr dramatisch, doch mit dem Hintergedanken, dass sie alle wahren Ursprungs sind, sind sie noch tragischer.
Johanna Mayr
Ferdinand v. Schirach, Schuld. BTB, 199 Seiten, 10 Euro.
Wer zuletzt lacht
Manche Menschen will man nicht mögen. Dovele Grimstein ist einer von ihnen. Er ist ein unangenehmer Zeitgenosse, ein verbitterter Komiker am Rand der Gesellschaft. An seinem Geburtstag tritt er zum letzten Mal in einer israelischen Kleinstadt auf. Mit gewohnt mittelmäßigen Scherzen sichert er sich anfangs die Aufmerksamkeit des Publikums. Doch das Ziel, das er mit seiner Show verfolgt, ist ein gänzlich anderes: Dovele stellt sich selbst vor den Richter. Spricht vom Schicksal seiner jüdischen Familie zu Zeiten des Nationalsozialismus und von prägenden Episoden aus seiner Kindheit. Während ein Zuschauer nach dem nächsten den Saal verlässt, blüht er in seinen verzweifelten Tiraden gegen sich und die Welt auf. Und je weiter der verdrossene kleine Mann sich das Herz aufreißt, umso schonungsloser gestaltet sich die Konfrontation mit zwei Figuren aus seiner Vergangenheit.
Zurück bleiben Beklommenheit, zögerliches Amüsement, das von Niedergeschlagenheit und Grausamkeit getrübt wird, und die Verbitterung eines alten Männchens. Nicht alles, was Sommer ist, muss Spaß machen.
Lisa Fulterer
David Grossman, Kommt ein Pferd in die Bar. Hanser 2016, 256 Seiten, 12 Euro.
Mal schau’n, was passiert
„Ihr Gynäkologe hat ihn mir empfohlen.“ Nicht nur Journalisten legen Wert auf den ersten Satz, auch Schriftsteller, in diesem Fall der US-Amerikaner John Irving (77). Seine Romanfigur, Fred „Bogus“ Trumper, sitzt beim besten Urologen New Yorks, denn Trumper hat Probleme beim Wasserlassen. Kein süß-sinnlicher Romanbeginn, sondern ein schmerzhafter.
Worum es in dem 1972 im englischen Original erschienenen Roman eigentlich geht, lässt sich leicht beantworten: Es geht um das Leben von Fred „Bogus“ Trumper, einem gescheiten, aber gescheiterten Doktoranden, der als Tontechniker arbeitet, um seine Frau Biggie, Sohn Colm und sich irgendwie durchzubringen. Was das aber für ein Leben ist, das Trumper führt, ist kaum zu beantworten: Der Roman flippert zwischen den USA und Österreich, Biggies und Tulpens Bett, dem Tonstudio, der Universität und einer Drogenrazzia.
Ein skurriles, witziges Buch, mit vielen narrativen Verästelungen, die immer wieder überraschen. Ich hab noch 40 Seiten, mal schau’n, was passiert.
Andrej Werth
John Irving, Die wilde Geschichte vom Wassertrinker. Diogenes 1992, 496 Seiten, 14 Euro.
Unter der Lupe
Jeder Wandel, schreibt Cornelia Koppetsch in ihrem neuen Buch, ähnelt der Vertreibung aus dem Paradies. Was hat uns nun daraus vertrieben oder was machen die Menschen dafür verantwortlich? Es ist eine Globalisierung, die nicht mehr als Glücksbringer, sondern als „Explosion von Ungleichheiten“ verstanden wird. In „Die Gesellschaft des Zorns“ hat Koppetsch (52, Professorin für Soziologie an der TU Darmstadt) den Blick geweitet. Denn nach polemischen Äußerungen in diversen Medien konnte man sie als Teil einer migrationskritischen Linken missverstehen. Fixiert auf die Migration als Kern allen Übels. Koppetsch operiert mit dem ganzen Besteck der Soziologie, das macht das Buch zu einer fordernden Lektüre. Doch es lohnt sich, ihrem Scharfsinn zu folgen, mit dem sie die „soziale Frage“, die „Neuordnung des politischen Raums“, „neue Trennlinien“ oder die „illiberale Gesellschaft“ untersucht. Zumal sie ihr eigenes Milieu nicht schont, den sogenannten „aufgeklärten“ Mittelstand.
Georg Mair
Cornelia Koppetsch, Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter. Transcript 2019, 283 Seiten, 21,40 Euro
Danke, Joseph Roth!
Während Irvings Geschichte vom Wassertrinker (siehe links) weniger Lesern bekannt sein dürfte, Joseph Roths „Radetzkymarsch“ gehört zum Kanon der deutschsprachigen Literatur. Und das zu Recht.
Joseph Roth (1894–1939), ein Kind der österreichisch-ungarischen Monarchie, begann bereits während des Ersten Weltkrieges als Journalist, später auch als Schriftsteller zu arbeiten; seine Arbeiten sezieren den Gemütszustand der Monarchie, lassen den Untergang einer Epoche spüren, stimmen zum Abgesang auf eine Zeit an, die in ihren letzten Zügen liegt – wunderbar!
Besonders beeindruckend ist Roths „Radetzkymarsch“ (1932), eine drei Generationen umspannende Familiengeschichte. Der Aufstieg und Fall der Familie von Trotta ist die Geschichte vom Ende der K.u.K.-Monarchie. Ein Roman, der auch Jahre nach der Lektüre nachwirkt. Roth, der sich in seinem Pariser Exil vor 80 Jahren zu Tode gesoffen hat, muss man für seinen Roman auch heute noch danken!
Andrej Werth
Joseph Roth, Radetzkymarsch. DTV 1998, 416 Seiten, 10,90 Euro.
Europa verstehen
Bild fragt Martin Sonneborn, wie er zu Brexit stehe. Der EU-Parlamentarier von „Die Partei“ antwortet: „Ich habe ja immer gesagt, dass die Briten nie zum Kontinent gehört haben. Mann kann auf jede Karte gucken, die gehören nicht dazu. Sie haben jetzt politisch nachvollzogen, was geographisch schon länger als seit Queen Mums Zeiten feststeht.“ Bild: „Wie sieht für Sie die bittere Zeit nach dem Brexit aus?“ Sonneborn: „Ich gehe erst mal shoppen nach London.“
Wem dieser hintergründige Humor gefällt, sollte sich „Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Abenteuer im Europaparlament“ nicht entgehen lassen. Martin Sonneborn erzählt darin, meist ironisch, manchmal auch derb, wie es in der EU zugeht. Es mag merkwürdig klingen, aber: Nach der Lektüre dieses Buches versteht man mehr von Europa, als man glauben möchte. Übrigens: Sonneborn erwähnt auch SVP-Mann Herbert Dorfmann, allerdings völlig spottfrei.
Karl Hinterwaldner
Martin Sonneborn, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Kiwi 2019, 430 Seiten, 18,50 Euro.
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

Stunk um Lagerhaus
Tisens – Obsthalle: (lf) Der Bau eines neuen Lagerhauses für die Obstgenossenschaft Cofrum am Ortseingang sorgt für Furore ...
-

Fehlende Klarheit
Flughafen – Offener Brief gegen Arno Kompatscher: (doc) Dreizehn Eppaner Vereine machen ihrem Ärger über das Vorgehen des ...





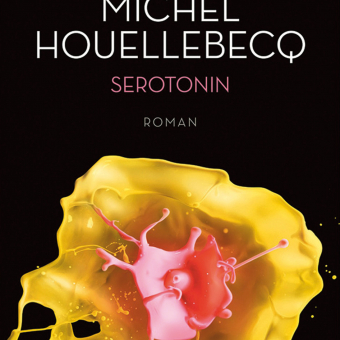
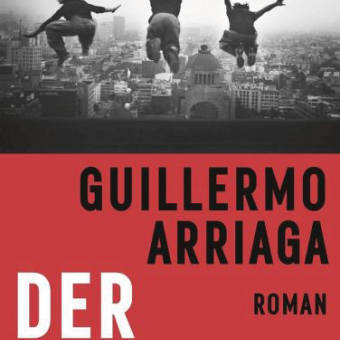
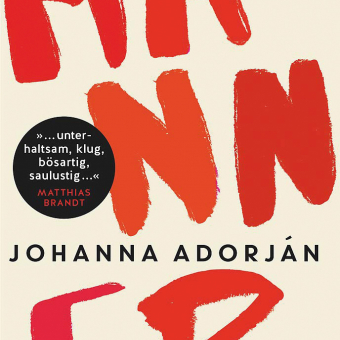


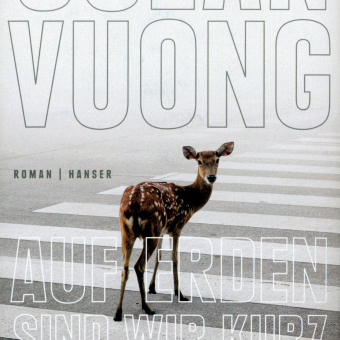
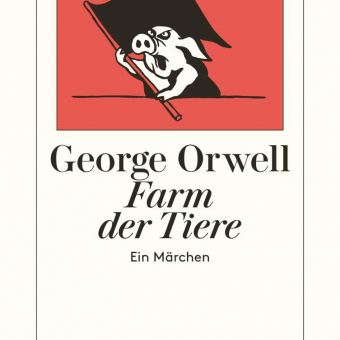
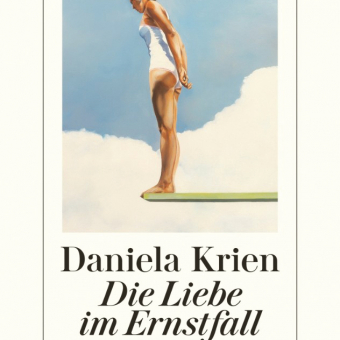
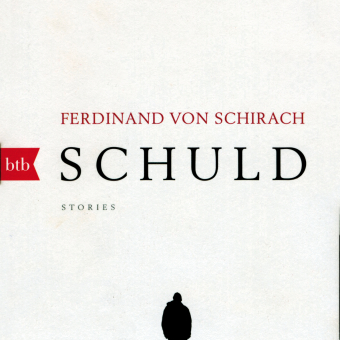



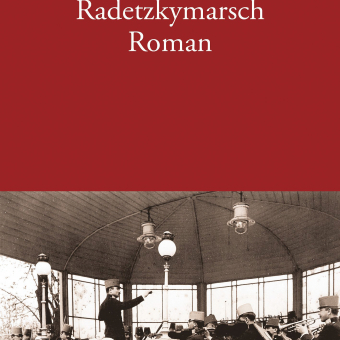












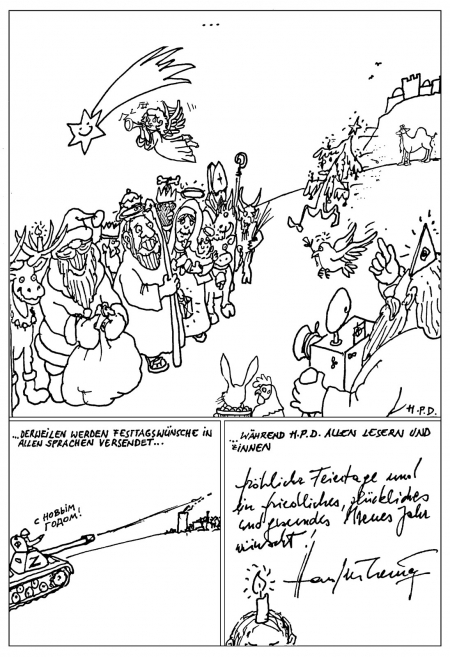






Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.