In der Coronakrise zeigt sich einmal wieder, welchen Stellenwert Kinder und Familien in der Politik haben. Keinen besonders hohen.
Kultur
So fern – so nah
Aus ff 17 vom Donnerstag, den 23. April 2020

Wir chatten auf WhatsApp, schicken über Facebook Fotos um die Welt, nehmen im Home Office an Videokonferenzen teil. Immer schon haben große Innovationen unsere Kommunikation geprägt.
von Claudia Sporer-Heis:
Mit Großeltern zu telefonieren, mit Freunden zu chatten oder sich digital zu informieren, ist gerade in der derzeitigen prekären Situation zu einer nicht zu unterschätzenden Notwendigkeit geworden. Trotz geschlossener Schulen werden Schüler online mit Aufgaben versorgt, um so das Bildungssystem einigermaßen aufrechtzuerhalten. Jugendliche und Erwachsene kommunizieren auch via Instant-Messaging-Dienste und nutzen Social Media, mit allen Vor- und Nachteilen, mehr denn je.
„So fern – so nah. Eine Kulturgeschichte der Telekommunikation“ nennt sich die aktuelle Ausstellung im Museum Innsbrucker Zeughaus. Mitte Februar eröffnet, musste sie aufgrund der gegen die Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen umgehend wieder geschlossen werden. Doch gerade durch diese weltweite Krise hat das Thema eine zusätzliche, nicht vorhersehbare Aktualität erhalten. Vielleicht ist es gerade jetzt reizvoll, sich mit der Kulturgeschichte der Telekommunikation zu beschäftigen.
Reiterpost & Kreidfeuer. Schriftliche Nachrichten, die von Boten überbracht wurden, waren bereits in Altertum und Mittelalter üblich. Maximilian I., der gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Familie Taxis mit der Einrichtung von Postverbindungen beauftragte, gilt als Begründer der neuzeitlichen Post. Reiter, die an bestimmten Stationen ihre Pferde wechseln konnten, beförderten die Briefe zwischen Innsbruck und Mechelen (Belgien) im Sommer in fünfeinhalb Tagen beziehungsweise in sechseinhalb Tagen im Winter. Das Übermitteln von Nachrichten per Postkutsche kam Mitte des 18. Jahrhunderts nicht nur dem Adel, dem Staat und der Wirtschaft zugute, sondern ermöglichte es auch dem wohlhabenden, gebildeten Bürgertum, Korrespondenzen zu führen. Eisenbahn und Dampfschiff beschleunigten im 19. Jahrhundert den Transport von Briefsendungen. 1869 wurde in Österreich die „Correspondenzkarte“ mit eingedrucktem Postwertzeichen eingeführt, mit welcher kurze Nachrichten problemlos versandt werden konnten. Ab Mitte der 1880er-Jahre dienten Ansichtskarten, die Grüße übermittelten, im Zuge des aufkommenden Tourismus auch der Bewerbung des Urlaubsgebietes im In- und Ausland.
Noch Anfang der 1950er-Jahre war die schriftliche Kommunikation per Post die einzige Möglichkeit, sich einfach und kostengünstig mit Adressaten auf der ganzen Welt zu verständigen. Spätestens seit Mitte der 2000er-Jahre hat jedoch die digitale Telekommunikation den traditionellen Brief und die Postkarte ersetzt.
Während mithilfe von Briefen auch ausführliche Nachrichten versendet werden konnten, dienten etwa Kreidfeuer, die systematisch an vorgegebenen Stellen entzündet wurden, als Warnsignale. Eine Kombination aus beiden stellte der optische Telegraf dar, der in der Zeit der Französischen Revolution von Claude Chappé erfunden und eingesetzt wurde. Mithilfe zweier schwenkbarer Querbalken, die an einem hohen Mast befestigt waren, konnten mit Buchstaben, die durch einen Code verschlüsselt waren, Nachrichten rasch über weite Strecken hinweg an verschiedene Stationen gesendet werden. Dieses System, das in Österreich nicht eingeführt wurde, konnte vor allem in Frankreich, England und Preußen – in erster Linie für staatliche und militärische Zwecke – erfolgreich eingesetzt werden, allerdings nur, wenn die Sicht gut war.
Der optische Telegraf spielte übrigens im Zusammenhang mit der Verurteilung Andreas Hofers in Mantua eine zentrale Rolle. Der Befehl, ihn am 20. Februar 1810 hinzurichten, wurde von Eugène de Beauharnais, Vizekönig von Italien und Stiefsohn Napoleons, in höchster Eile mithilfe optischer Telegrafen von Mailand nach Mantua übermittelt. Es sollten wohl Interventionen vonseiten Österreichs zugunsten Hofers sowie eine Gefährdung der geplanten Hochzeit von Napoleon und der Tochter des österreichischen Kaisers Franz I., Marie Louise, vermieden werden.
Telegrafisch schreiben. Der optische Telegraf hatte den Nachteil, dass er in der Nacht und bei schlechter Sicht nicht zum Einsatz kommen konnte. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden Versuche unternommen, auf elektrochemischem beziehungsweise elektromagnetischem Weg schriftliche Nachrichten zu übermitteln. Den Durchbruch schaffte 1832 der amerikanische Erfinder Samuel Morse mit seinem Schreibtelegrafen und dem nach ihm benannten Morsealphabet, bestehend aus Kombinationen von Punkten und Strichen. Dabei verwendete er den erst kürzlich bekannt gewordenen Elektromagneten.
In Österreich begannen ab 1846 Telegrafierversuche, 1849 wurde das Morsesystem eingeführt. Die Telegrafenleitungen wurden auf 3.500 Kilometer Länge ausgebaut. Ab 1850 war Innsbruck telegrafisch erreichbar. Bis zum Ende des Jahrhunderts wurden auch Seitentäler Gesamttirols erschlossen, was auf den zunehmenden Tourismus in Tirol zurückzuführen war.
Ab 1885 kamen in Innsbruck sogenannte Typendrucktelegrafen („Hughes-Apparate“) zum Einsatz, bei denen die Buchstaben (ohne Verwendung des Morsealphabets) direkt auf einen Papierstreifen gedruckt wurden. In der Folge war eine erhebliche Steigerung der Übertragungsgeschwindigkeit gegeben, und es wurde auch technisch möglich, mehrere Nachrichten gleichzeitig über eine Leitung zu senden.
Das Bedürfnis nach immer noch schnellerer Nachrichtenübermittlung führte zur Entwicklung des Fernschreibers, der in Innsbruck 1936 erstmals eingesetzt wurde. Nun war es auch für Firmen möglich, über eine schreibmaschinenartige Tastatur direkt von Haus zu Haus zu telegrafieren. Ende der 1980er- Jahre übernahm die Aufgabe der schriftlichen Nachrichtenübermittlung das Telefaxgerät, mit dem Schriftstücke übermittelt werden konnten.
Mitteilungen durch die Röhre. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten schriftliche Eilnachrichten mithilfe der Telegrafie zwar sehr schnell in die Ferne verschickt werden, aber nach ihrem Einlangen in den Postämtern größerer Städte dauerte die direkte Zustellung an den Empfänger aufgrund des immer stärker werdenden Verkehrs relativ lange. Vor allem Börsenmitteilungen mussten rasch weitergeleitet werden, weshalb der Engländer Josiah Latimer Clark 1853 für diesen Zweck die erste Rohrpost von 106 Metern Länge in London errichtete. In der Folge wurden auch in anderen europäischen Großstädten – wie 1875 in Wien – unterirdische Rohrpostlinien gebaut, welche die Post- und Telegrafenämter miteinander verbanden.
Mit der Rohrpost wurden auch Rohrpostbriefe befördert, die man in eigene Briefkästen warf, welche in kurzen Abständen geleert wurden. Die Rohrpostsendung erfolgte in Metallkapseln („Pistons“), die mit Luftdruck zum Zielpostamt geschickt und in der Folge von einem Boten dem Empfänger zugestellt wurden. Die Postämter verfügten auch über Hausrohrpostanlagen, so wurde in Innsbruck 1908 in das neue Postamtsgebäude in der Maximilianstraße eine Leitung zwischen Telegrafensaal und Telegrafenschaltern gelegt. Die Rohrpostanlage der Stadt Wien, welche 1913 eine Länge von 68 km mit 53 Rohrpoststellen aufwies, musste 1956 aufgrund fehlender Rentabilität geschlossen werden. Heute finden wir Rohrpostanlagen vor allem im medizinischen Bereich, so verfügt die Innsbrucker Klinik über ein Rohrsystem von 50 km Länge mit 320 Stationen, auf dem 1.000 Kapseln mit Nachrichten und Laborproben unterwegs sein können.
Von Funken und Sprechtelegrafen. Dass mithilfe von Funkwellen Nachrichten übertragen werden können, wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts erkannt und im Bereich der Telegrafie genutzt. 1927 wurden auf der internationalen Weltfunkkonferenz in Washington unter anderem Regelungen hinsichtlich der Verwendung von Wellenfrequenzen getroffen. Dabei wurden bestimmte Frequenzbereiche auch den seit 1925 organisierten Funkamateuren überlassen, die bis heute weltweit, ohne kommerziellen Nutzen und ohne politische Äußerungen, nach Ablegung einer Prüfung experimentellen Funk mit bewilligten Funkstationen betreiben. Es werden sowohl Sprache als auch Daten und Bilder in unterschiedlichen Verfahren übertragen. In Not- und Katastrophenfällen sind Funkamateurinnen und Funkamateure in der Lage, Hilfsorganisationen wesentlich zu unterstützen.
Als Leopold Pfaundler 1877 in Innsbruck den ersten „Sprechtelegrafen“ vorführte, waren weltweite Versuche, Sprache zu übermitteln, zwar schon einige Jahre im Gang, das Patent für Alexander Bell in den USA war allerdings erst ein Jahr alt.
Das Telefonieren hatte den Vorteil, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt miteinander kommunizieren konnten, ohne – wie beim Telegrafieren – eine Person zu benötigen, die Codes in Schrift umwandelt. Die Gespräche wurden anfangs manuell über einen Klappenschrank weitervermittelt. Diese Arbeiten übernahmen in erster Linie Frauen, die sogenannten „Fräuleins vom Amt“, die einerseits zu den ersten berufstätigen Frauen zu zählen sind, andererseits aber mit hohen technischen Anforderungen bei schlechter Bezahlung, einem auferlegten Heiratsverbot und nicht vorhandenen Karriereaussichten zu kämpfen hatten.
1893 wurde in Innsbruck die erste Telefonzentrale mit 30 Anschlüssen in Betrieb genommen, weitere größere Tiroler Orte folgten diesem Beispiel. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem kostspieligen Vergnügen standen verschiedenartige Wand- und Tischapparate zur Verfügung. Mit der Zeit wurden auch Ferngespräche möglich.
In Österreich-Ungarn wurde am 17. August 1903 am Wiener Südbahnhof der erste öffentliche Münzfernsprecher in Betrieb genommen. 1907 gab es bereits 42 öffentliche Münzfernsprecher in Wien, in Tirol waren zu dieser Zeit erst zwei Geräte in den Bahnhöfen von Brixlegg und Trient im Einsatz.
Die Installierung eines vollautomatisierten Wählbetriebs, bei dem keine manuelle Vermittlung mehr nötig war, konnte erst nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen und Mitte der 1950er-Jahre abgeschlossen werden. Da Telefonieren lange Zeit sehr teuer war, gab es die Möglichkeit, sogenannte Gemeinschaftsanschlüsse („Viertelanschlüsse“) zu benützen. Dadurch waren zwar die Kosten geringer, aber das Telefonieren nur möglich, wenn keiner der anderen drei Partner sprach.
Nach der Automatisierung erhielten die Telefonapparate die bekannten Wählscheiben, mit denen man die gewünschte Telefonnummer, die man über die Auskunft oder das Telefonbuch erfuhr, direkt anwählen konnte. Später wurden diese durch Tastentelefone ersetzt. Bei der Nutzung von Schnurlostelefonen, die in den 1980er-Jahren aufkamen, war man nicht mehr an den fix montierten Apparat gebunden, sondern konnte sich innerhalb eines bestimmten Bereiches frei bewegen.
Mit der Einführung des digitalen GSM-Netzes ab 1992 wurde das analoge Netz abgelöst. Seine Weiterentwicklungen in den 2000er-Jahren ebneten den Weg für das Smartphone, das es uns heute ermöglicht, mit der ganzen Welt verbunden zu sein, zu telefonieren, Kurznachrichten zu schreiben, Bilder und Filme zu versenden. Eine Kommunikationsmöglichkeit, die noch vor 50 Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre und gerade in der Corona-Krise eine wesentliche Rolle spielt. n
Claudia Sporer-Heis ist Leiterin des Museums im Zeughaus Innsbruck und hat dort die Sonderausstellung „So fern – so nah. Eine Kulturgeschichte der Telekommunikation“ kuratiert.
Zur Ausstellung erschien die Begleitpublikation „So fern – so nah. Eine Kulturgeschichte der Telekommunikation. Studiohefte 37, Peter Assmann/Claudia Sporer-Heis (Hg.), Innsbruck 2020.
Erhältlich auch im Onlineshop der Tiroler Landesmuseen.
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

Wenn das Pasta-Wasser kalt wird
Ein Rückgang des italienischen Bruttoinlandprodukts im zweistelligen Prozentbereich scheint mit jeder Woche im Lockdown wahrscheinlicher. Was nun zu tun wäre.
-

Segen und Fluch
Das Nationale Fürsorgeinstitut ist dieser Tage das Beatmungsgerät der Nation. Doch nicht immer funktioniert es, wie es sollte.





















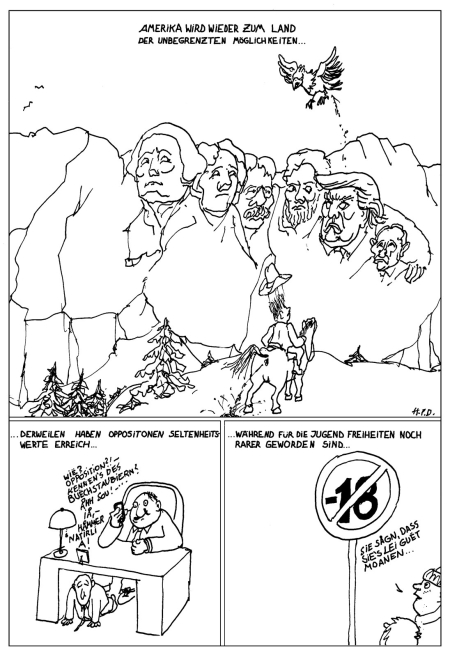






Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.