Theater – Vereinigte Bühnen Bozen: (gm) In der vergangenen Woche konnte man im Stadt-theater Bozen das gute alte Sprechtheater bei ...
Leitartikel
Wir müssen hören
Das Corona-Virus hat Spuren hinterlassen. Und Gräben aufgerissen. Sie zuzuschütten, erfordert Ehrlichkeit – auf allen Seiten.
Als die Pandemie ausbrach, war ich in Deutschland. Ich saß mit vielen Leuten in einem Raum. Es war Anfang März und kalt und dennoch standen die Fenster sperr-
angelweit offen. Irgendwann ploppte am Handy die Meldung auf: Schulen in Südtirol geschlossen. Eine Woche vorher hatten die Behörden noch nach dem ersten Corona-Fall Entwarnung gegeben. Auf dem Weg heim nach Bozen war der Zug voll. Die Leute fuhren aufgeregt in den Skiurlaub.
Ein paar Tage später sperrten die Skigebiete in Südtirol zu. Die Tourismuszentren waren Treiber der Pandemie. Die Ärzte dort stellten eine Grippe fest, die besonders schwer war und nicht aufhören wollte. Und manchmal tödlich endete. Masken, sich zu schützen, gab es kaum.
Wir wussten nichts über dieses Virus, das sich über die Welt verbreitete und sie erstarren ließ.
Es war eine unheimliche Zeit. Die vielen Toten, Hausarrest, Ausgangsbeschränkungen, Tests, Maskentragen, keine Schule, kein Sport, keine Kultur – auf und zu. Die Zahlen, die abebbten und wieder hochschnellten.
Viele Maßnahmen kann ich heute noch nachvollziehen. Das Tragen von Masken (damit man sich nicht ansteckt, damit man die anderen nicht ansteckt), die Beschränkungen, die Tests, die Impfung (bis heute, ich bekenne). Wäre das alles nicht gewesen, wären viel mehr Menschen vom Virus getötet worden.
Einiges ist heute nur mehr schwer zu verstehen: die Verbote, spazieren zu gehen, Sport zu treiben; die Unerbittlichkeit gegenüber Menschen, die mit den Maßnahmen nicht einverstanden waren; die Selbstverständlichkeit, mit der Kinder und Jugendliche daheim eingesperrt wurden; oder wie die Kultur, die gute Sicherheitskonzepte entwickelt hatte, zum völligen Stillstand gebracht wurde.
Es kann schnell gehen, dass wir uns die Freiheit nehmen lassen.
Ob wir etwas aus der Pandemie gelernt haben, ist unter anderem das Thema der Titelgeschichte in diesem Heft. Sind wir auf eine neue Pandemie vorbereitet? Was wir sicher nicht gelernt haben, ist unser Leben zu entschleunigen – das war die übertriebene Erwartung. Wenig geblieben ist auch von der Solidarität, die es gab unter vielen Menschen.
Geblieben ist freilich ein Graben. Die Politik, die sich damals vortasten musste, will die Pandemie nicht wirklich aufarbeiten. Auch wenn die Politikerinnen und Politiker nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben – es gab keine Verschwörung, um den Menschen die Freiheit zu nehmen oder Impfstoffe zu verkaufen.
Den Graben nicht zuschütten wollen auch diejenigen, die die Pandemie für harmlos halten, für eine Erfindung der Pharmaindustrie, die die Maßnahmen als Freiheitsberaubung betrachteten. Für einige ist die Bewirtschaftung der Pandemie ihre politische Existenzgrundlage. Es gibt viele Menschen, die ehrliche Bedenken hatten. Für sie ist die Aufarbeitung wichtig. Ihnen muss man zuhören und die Größe haben, Fehler
einzugestehen.
Aber Dialog kann nicht heißen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu leugnen. Dialog kann nicht mit einem Schuldbekenntnis beginnen – das kommt einer Unterwerfung gleich. Dialog funktioniert nur mit Reden und Zuhören.
Weitere Artikel
-

-

„Hohe Vitalität“
Das Deutsch in Südtirol ist nicht gefährdet. Das hat die deutsche Akademie für Sprache und Dichtung erforscht. Wie wir reden und schreiben.
-

Endlich mal abhängen
Thomas Schrott führt zwei gut gehende Feinkostgeschäfte in Bozen. Nun hört er auf. Weil er müde ist – und es sich leisten kann.






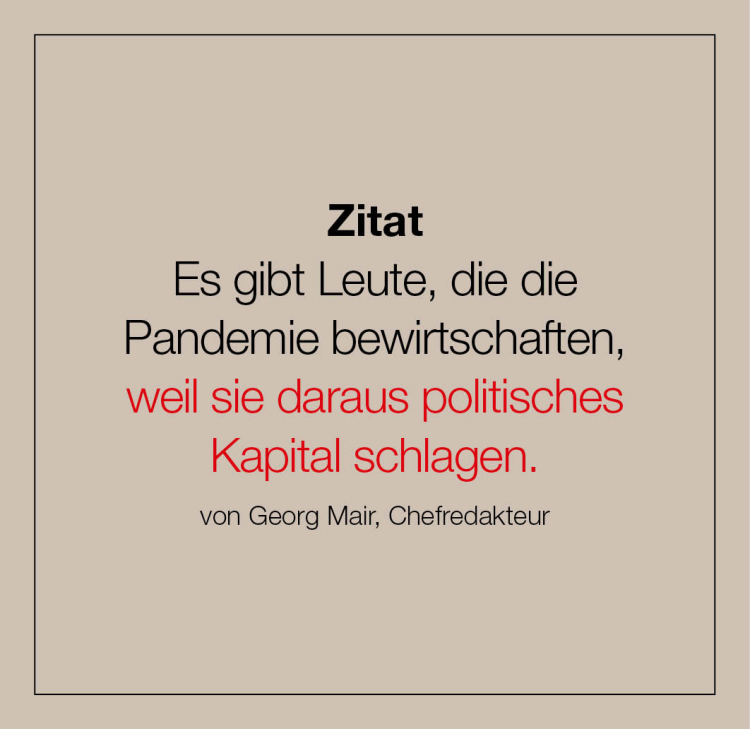










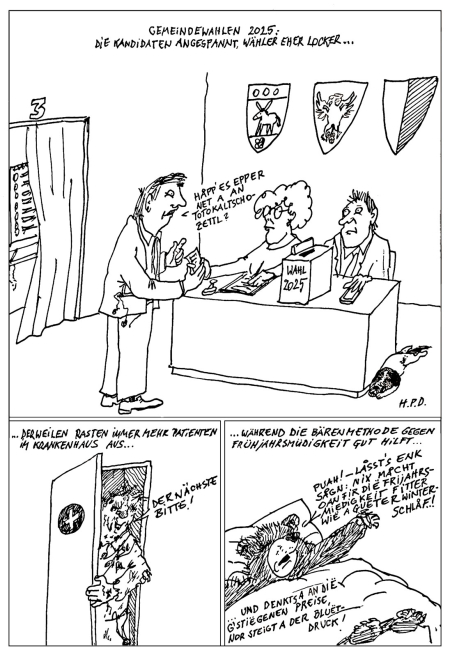






Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.